Budapest/Stockholm. Mit der Verleihung des Nobelpreises für Literatur 2025 an László Krasznahorkai rückt ein Autor ins weltweite Rampenlicht, der in den letzten Jahrzehnten vor allem im literarischen Kosmos – nicht in den Massenmedien – eine zentrale Rolle eingenommen hat. Die schwedische Akademie würdigte ihn „für sein überzeugendes und visionäres Œuvre, das mitten in apokalyptischer Finsternis die Kraft der Kunst stärkt“.
Er ist erst der zweite Ungar, dem diese Ehre zuteilwird ,nach Imre Kertész 2002.
Leben und literarischer Werdegang
Krasznahorkai wurde am 5. Januar 1954 in Gyula geboren. Er studierte zunächst Recht in Szeged, später Ungarische Sprache und Literatur in Budapest. Früh zeigte sich sein Interesse an Fragen von Existenz, Ordnung und Verfall – Themen, die sein gesamtes Werk durchziehen.
Sein literarischer Durchbruch kam 1985 mit dem Roman Sátántangó, in dem eine einst gemeinschaftliche Dorfgemeinschaft ihres Zusammenhalts und ihrer Illusion beraubt wird. Der Roman, streng strukturiert und mit sehr langen, verschlungenen Sätzen, wurde schnell zu einem Kultstück ungarischer Literatur.
In den folgenden Jahren veröffentlichte er unter anderem The Melancholy of Resistance, War and War, Seiobo There Below und Baron Wenckheim’s Homecoming. Besonders Seiobo There Below erregte Aufmerksamkeit im englischsprachigen Raum.
Parallel zu seiner schriftstellerischen Tätigkeit entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Filmregisseur Béla Tarr. Aus dieser Kooperation gingen Filmadaptionen von Sátántangó und Werckmeister Harmonies hervor, die sowohl visuell als auch narrativ seine literarischen Ideen in bewegte Bilder übertrugen.
In Interviews spricht Krasznahorkai über seine Neigung zur Absurdität, darüber, wie die Welt sich „personifiziert“ und gegen das Individuum wenden kann – dass das Schreibhandwerk selbst ein Widerstand gegen Bedeutungsverlust ist.
Stil, Themen und literarische Ausrichtung
Eine der auffälligsten Eigenschaften seines Schreibstils ist die Verwendung extrem langer, verschlungener Sätze oft über Seiten hinweg, die kaum Unterbrechung durch klassische Satzzeichen kennen. Diese Technik erzeugt eine Art „Strom des Bewusstseins“, in dem Zeit, Bewusstsein und Beobachtung verschmelzen.
Kritiker nennen diesen Stil zugleich hypnotisch und herausfordernd: Er verlangt Geduld, Gedankenschärfe und ein offenes Lesen.
Apokalyptik, Verfall und existentielle Leere
Ein unerschöpfliches Thema in seinen Romanen ist der Zerfall – von Gemeinschaft, Ordnung, Moral, Struktur. In fast jeder Erzählung ist die Rede von einem kosmischen oder gesellschaftlichen Ungleichgewicht, das unausweichlich zum Chaos führt.
Zeitweise werden religiöse, metaphysische und theologische Implikationen angerissen – ohne dass er allerdings in eine dominante Weltanschauung abgleitet. Er lässt den Raum offen, verliert sich nicht in Ideologie.
Ostasiatische Einflüsse
Die Jury betonte, dass Krasznahorkai in späteren Werken stärker östliche Imaginationen aufnimmt – Reisen nach China und Japan hätten sein Denken geprägt. In seinen Texten spüren viele Leser eine meditative Verlangsamung, Reflexion und leise Sensibilität.
Rückkehr zur Kunst als Hoffnung
Die schwedische Akademie spricht bewusst davon, dass sein Werk „die Kraft der Kunst stärkt“ gerade dort, wo das apokalyptische Unheil überhandnimmt. In seinen Texten bleibt oft ein Riss, eine Sehnsucht, eine Spur von Musik – als Widerstand gegen die finale Leere.
Rezeption und Kritik
In literarischen Kreisen wird Krasznahorkai als einer der konsequentesten und mutigsten Gegenwartsautoren geschätzt. Sein Werk gilt als Grenzgänger zwischen Literatur, Philosophie und Kino.
Autoren und Kritiker würdigen ihn beispielsweise als jemanden, der das Potenzial der literarischen Sprache auslotet. In The Guardian wird sein Werk als „visionär, eindringlich und düster“ beschrieben.
Der AP-Report verortet ihn in der Tradition mit Kafka und Thomas Bernhard, insbesondere aufgrund von absurden Sujets und existenzieller Intensität.
Seine literarische Bedeutung spiegelt sich auch in Auszeichnungen: Er gewann unter anderem den International Booker Prize 2015.
Doch Krasznahorkai ist nicht unangefochten – seine radikale Form und dichte Sprache rufen auch Skepsis hervor.
- Überdichte Prosa und Erschöpfung
Manche Kritiker empfinden seine Texte als ermüdend, repetitiv oder gar monoton. In einem Artikel von La Review of Books heißt es: „Krasznahorkai’s Beschreibungen schmelzen manchmal zu langweiligem Wiederholen und verlieren Rhythmus oder Phantasie.“ Die extreme Länge der ununterbrochenen Absätze kann Leserinnen und Leser abschrecken und die Wirkung in eine bloße Last verwandeln. - Stil über Inhalt?
In manchen Rezensionen wird bemerkt, dass die stilistische Virtuosität zum Selbstzweck gerät – dass die philosophischen Aussagen darunter leiden könnten. Kritiker fragen, ob seine Texte an einer inneren Dramaturgie mangeln und nicht genügend narrative Spannung bieten. - Mehr Mystizismus als Klarheit
Weil er bewusst Ambiguität zulässt, bleiben seine Texte reich an Interpretationsspielräumen – für manche ein Vorzug, für andere eine Frustration. Der Wunsch nach klaren moralischen Konklusionen oder stärker durchkomponierten Plots wird gelegentlich geäußert. - Persönliche Zurückhaltung und öffentliche Stellungnahmen
Krasznahorkai ist kein politischer Lautsprecher im klassischen Sinn – er spricht selten öffentlich und überlässt den Interpretationen Raum. Dennoch hat er sich gelegentlich kritisch gegenüber der politischen Entwicklung in Ungarn geäußert, insbesondere gegenüber der Regierung von Viktor Orbán. Seine Wortmeldungen sind oft indirekt, reflektiert, manchmal skeptisch gegenüber technologischem Fortschritt und Machtstrukturen. Diese Zurückhaltung macht ihn in politischen Diskursen angreifbar – wer klare Stellungnahme erwartet, könnte enttäuscht sein.
Die Entscheidung der Schwedischen Akademie, László Krasznahorkai den Nobelpreis für Literatur zu verleihen, ist weit mehr als eine individuelle Ehrung – sie ist ein kulturpolitisches Statement. In einer Zeit, in der Literatur zunehmend auf Verständlichkeit, Marktgängigkeit und moralische Eindeutigkeit getrimmt wird, ehrt das Komitee einen Autor, dessen Werk der Dunkelheit, der Langsamkeit und der intellektuellen Herausforderung verpflichtet bleibt.
Quellen: The Yale Review, The Paris Review, The Guardian, AP News, lemonde.fr, lithub.com
Photo: von Miklós Déri – Déri Miklós: Arcok (Wikimedia.org)
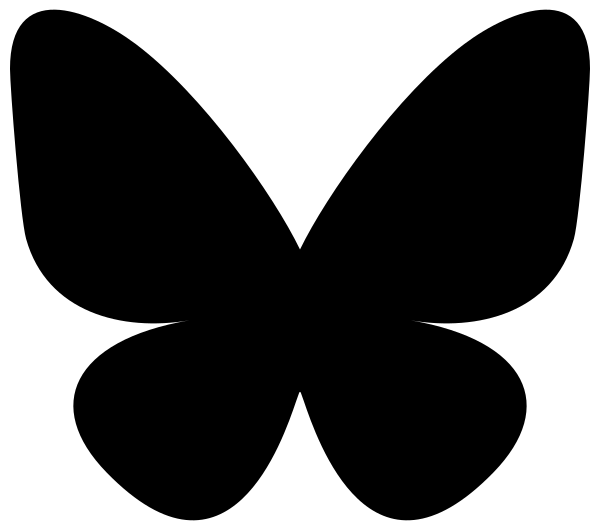





Gib den ersten Kommentar ab