Ungarns Energiepolitik im Schatten des russischen Öl-Embargos: MOL beklagt Isolation, Brüssel kontert mit Fakten – ein Streit über Infrastruktur, Tarife und Verantwortung
Budapest. Der jüngste Beitrag auf Index.hu suggeriert, die Europäische Union lasse Ungarn beim Ausstieg aus russischem Öl im Stich. Insbesondere die MOL-Gruppe warnt vor einem Versorgungskollaps ab 2028, sollte es nicht gelingen, neue Pipelines zu errichten – etwa nach Serbien oder zur ukrainischen Schwarzmeerküste. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich: Die Darstellung beruht auf einseitigen Annahmen und verschweigt wesentliche Fakten, die sowohl Brüssel als auch Zagreb längst vorgelegt haben.
Kern der Kritik ist die Adriatische Pipeline (JANAF), über die derzeit Öl von der kroatischen Insel Krk ins ungarische MOL-Raffinerienetz gelangen soll. MOL moniert zu geringe Transportkapazitäten und „überzogene“ Gebühren – laut Konzernchef Szabolcs Pál Szabó zahle man vier- bis fünfmal so viel wie der europäische Durchschnitt. Das gefährde die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer Diversifizierung, heißt es sinngemäß.
Kroatiens Position fällt nüchterner aus. Die Transportgesellschaft JANAF verweist auf das nutzungsabhängige Preismodell und darauf, dass Ungarn bisher weder langfristige Abnahmezusagen noch Investitionsbeteiligung signalisiert habe. Die tatsächliche Förderkapazität liege bei rund 34 Millionen Tonnen pro Jahr – laut unabhängigen Analysen ausreichend, um Ungarns Bedarf auch nach dem russischen Ausstieg zu decken.
Auch die Europäische Kommission sieht keinen unmittelbaren Versorgungsengpass. Auf Anfrage teilte ein Sprecher mit, es gebe „keine Hinweise darauf, dass die derzeitige Infrastruktur die Versorgungssicherheit Ungarns oder der Slowakei gefährdet.“ Vielmehr betont Brüssel, dass alternative Routen verfügbar seien – sofern man bereit sei, in sie zu investieren.
Ein solcher Weg wäre die Nutzung und Erweiterung der TAL-Pipeline, die Öl vom italienischen Triest über Deutschland nach Tschechien transportiert. Die tschechische Regierung hat ihre Hausaufgaben gemacht: Sie investierte 1,6 Milliarden Kronen (rund 65 Millionen Euro) in die Verdopplung der TAL-Kapazität – allein aus Eigenmitteln. Seit April 2025 erreichen erste Lieferungen aus Triest das tschechische Verteilzentrum in Nelahozeves. Doch diese Leitung hilft weder Ungarn noch der Slowakei direkt – das Netz ist nicht durchgängig kompatibel.
Ungarns Fokus liegt daher auf zwei anderen Projekten: dem Ausbau der eigenen Adria-Pipeline-Sektion sowie der Errichtung einer neuen Leitung nach Serbien. Bereits 170 Millionen US-Dollar wurden in den ungarischen Abschnitt investiert, weitere 500 Millionen sollen bis 2026 folgen – aus MOL-Mitteln. Der serbisch-ungarische Ölstrang (Algyő–Novi Sad) ist genehmigt, die Bauarbeiten sollen noch 2025 beginnen. Die geplante Jahreskapazität: rund fünf Millionen Tonnen.
Doch MOL fordert mehr – nämlich aktive Unterstützung durch Brüssel. Konkret verlangt der Konzern, dass die EU sich an Infrastrukturinvestitionen beteiligt, auf Kroatien Druck wegen der Tarifgestaltung ausübt und den Ausbau der Verbindung zum ukrainischen Hafen Odessa koordiniert. Letzterer gilt als strategisches Ziel, um Zugang zu nicht-russischem Öl per Schiff zu sichern. Ein Ausbau der Leitung Odessa–Brody könnte langfristig Serbien, Ungarn und die Ukraine selbst versorgen – ohne russische Beteiligung.
Dabei ist bemerkenswert: Während MOL Milliarden investiert, hat die EU bislang keine vergleichbaren Fördermittel bereitgestellt-– anders als im Gassektor, wo Projekte wie der TAP (Trans Adriatic Pipeline) großzügig unterstützt wurden. Die Energiestrategie der Union setzt vielmehr auf Marktmechanismen – und erwartet von nationalen Konzernen wie MOL Eigeninitiative, bevor gemeinschaftliche Mittel fließen.
Gleichzeitig muss sich die ungarische Regierung fragen lassen, warum sie nach wie vor am russischen Öl festhält. Während Tschechien und Polen ihre Versorgungsstruktur erfolgreich umstellen, insistiert Budapest auf Zeitgewinn – und präsentiert sich als Opfer einer angeblich kurzsichtigen EU-Politik.
Dabei zeigen aktuelle Entwicklungen: Diversifizierung ist machbar, wenn sie politisch gewollt und wirtschaftlich vorbereitet wird. Die Kapazitäten sind vorhanden oder im Bau, alternative Versorgungswege in greifbarer Nähe – was fehlt, ist ein kooperativer Ton und der Wille, europäische Verantwortung zu teilen. Nicht die EU lässt Ungarn allein – sies setzt auf nationale Reife und europäische Solidarität in beiderseitigem Interesse. Ein Risiko, das weniger technischer als politischer Natur ist.
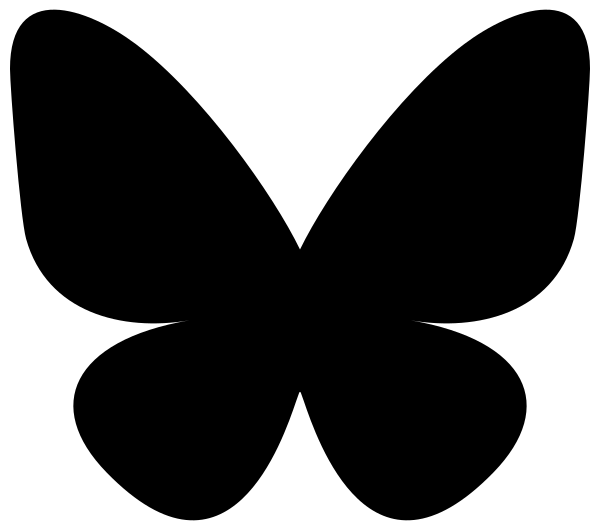




Gib den ersten Kommentar ab