Graz. ORF-Kriegsreporter Christian Wehrschütz hat in seinem neuen Buch „Frontlinien“ seine Erfahrungen aus 25 Jahren Kriegsberichterstattung auf dem Balkan und zuletzt in der Ukraine verarbeitet. 2026 wird er in Pension gehen. Wir haben in einem Interview Fragen zum Ende des Krieges in der Ukraine, die Rolle Ungarns und kolportierte Diskriminierung der Magyaren in Transkarpatien behandelt.
Jasper Reichardt: Herr Wehrschütz, Sie eröffnen Ihr neu erschienenes Buch Frontlinien mit einem Zitat von Otto von Bismarck. Ich verstehe das Zitat so: Für große Staatsmänner wie Vladimir Putin sei es leicht, einen Krieg zu beginnen – aber man braucht sehr gewichtige Gründe, damit der Kriegsgrund auch nach dem Krieg Bestand hat; sonst fehlt jede rationale Legitimation.
Christian Wehrschütz: Unter den großen Außenpolitikern und Denkern nimmt Bismarck zweifellos eine herausragende Rolle ein. Ich habe viel von ihm gelesen, und dieses Zitat habe ich aus mehreren Gründen dem Buch vorangestellt: Erstens als Gegenstatement zur Kriegspropaganda – hinter Kriegen stehen Interessen. Seit dem Ersten Weltkrieg tendiert man dazu, Massenbevölkerungen mit moralischen Gründen zu mobilisieren – teils zutreffend, teils nicht – doch gerade solche Elemente sind integraler Bestandteil der Kriegspropaganda.
Zweitens verweist das Zitat auf das lateinische Prinzip Cui bono – wem nützt es? Warum führt man Krieg? Drittens ist es kein Zitat, das allein auf Putin passt. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben auch die USA vermehrt Kriege geführt. Das Zitat gilt allgemein für Staatsmänner – es verweist auf das, was Clausewitz mit „einen Krieg vom Ende her denken“ umschrieben hat. Man muss überlegen: Welches Ergebnis ist denkbar? Wozu könnte der Krieg führen?
Wenn man als Sieger aus einem Krieg hervorgeht, braucht man oft nicht groß über Legitimation nachzudenken – Sieger schreiben Geschichte. Doch die entscheidende Frage lautet: Wie verkaufe ich meiner Bevölkerung die Notwendigkeit dieses Kriegs? Putin ist nicht gleich Stalin -demnach steht auch er, wenn auch nicht so stark wie westliche Politiker – in der Pflicht, die Legitimität seines Handelns zu erklären. Die Frage der Kriegsziele ist essentiell für die Frage, wie ein Krieg beendet werden kann. Wenn die Ziele zu weit von den realen Ausgangspunkten (Der Lage an der Front oder der politischen Realität) abweichen, wird es sehr schwierig.
Ein Kriegsende ohne Verhandlungslösung ist derzeit nicht in Sicht, und auch diese Tatsache steht mit dem Zitat in Verbindung.
Was Perry Rhodan betrifft: Ich definiere mich nicht als Weltbürger, sondern zunächst als Steirer, dann als Österreicher, dann als Europäer. Dennoch glaube ich, dass wir über Rasse, Religion, Kultur hinaus Gemeinsamkeiten erkennen und entwickeln müssen, damit alle Bewohner des Planeten Erde eine Zukunft haben.
Das Zitat soll Hoffnung geben: Es betont, dass uns viel verbindet – auch wenn uns derzeit mehr trennt als eint. Die Aufrüstung auf allen Seiten ist derzeit offenbar wichtiger als die Frage wie wir die Weltbevölkerung so positionieren können, dass gemeinsame Ziele entstehen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war zeitweise die Vorstellung im Raum, der Kosmos könne eine gemeinsame Herausforderung sein – diese Idee ist allerdings verblasst.
„Wenn die Kriegsziele extrem weit von den Vorstellungen der Kriegsparteien abweichen, ist es sehr viel schwieriger, zumal die Ukraine nicht in einer Situation ist, in der ihr Zusammenbruch bevorsteht und auch in Russland keine Entwicklung absehbar ist die zu einem neuen Lenin führen könnte. Somit bleibt in letzter Konsequenz nur eine Verhandlungslösung. “
Die gegenwärtige Blockbildung beunruhigt mich als Großvater. Ich frage mich: Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern und Enkeln?
Im Buch habe ich bewusst wenige Zitate verwendet. Es soll keine wissenschaftliche Dissertation sein, sondern ein lesbarer Text. Neben Bismarck und Perry Rhodan tauchen nur Karl May und ein Balkanhistoriker als Belege auf.
Was war Ihr persönlicher und journalistischer Beweggrund, dieses Buch gerade jetzt zu schreiben?
Der Krieg in der Ukraine dauert nun bald vier Jahre. Hinzu kommt: In Europa existiert noch eine Zone, die politisch nicht abschließend definiert ist: der Balkan. Dort geht der versprochene EU-Integrationsprozess seit etwa 15 Jahren kaum voran.
Mein Ziel war es, Zusammenhänge zwischen der Ukraine und dem Balkan herauszuarbeiten – gemischt mit journalistischen Perspektiven und eigenen Erfahrungen außerdem war ich bestrebt, die historischen und politischen Entwicklungen aufzuzeigen. Das Buch ist modular aufgebaut: Man muss nicht zwingend von Seite 1 beginnen, sondern kann nach Interesse einzelne Kapitel aufschlagen.
Welche zentrale Botschaft wollen Sie über die tägliche Kriegsberichterstattung hinaus vermitteln? Ein Bruch mit der oft vorherrschenden Schwarz-Weiß Sicht, Osten gegen Westen?
Ja, Ich möchte über Schwarz-Weiß-Muster hinausführen. Aus diesem Grund beginne ich das Buch mit Sokrates – als Hinweis darauf, dass wir unser Wissen als Journalisten stets als begrenzt verstehen müssen. Wir haben oft keinen direkten Zugang zu Entscheidungsträgern, wissen nicht was wirklich besprochen wird.
Beispielsweise weigert sich ein gewisser Oligarch namens Rinat Achmetow bis heute, mir ein Interview zu geben – obwohl seine Perspektive für die Analyse des Konflikts im Donbas seit 2014 von großer Bedeutung wäre.
Wie schätzen Sie die strategischen Ziele Russlands heute ein – und wie realistisch ist eine militärische Lösung aus ukrainischer Sicht? Donald Trump hat ja jüngst überraschend verlautbart, dass eine militärische Lösung – eine Rückeroberung aller besetzten Gebiete – realistisch sei.
Das erste Problem ist die Wahrnehmung: Hat Trump einen persönlichen Friedenswillen – oder sind seine Worte Teil seiner Schwankungen? Sind seine zuletzt geäußerten Positionen zuverlässig? So haben wir erst jüngst nach dem Telefonat Putins mit Trump und dem Treffen Trump mit Selenskyis in Washington wieder eine Wendung in der Trump’schen Rhetorik erlebt.
Wir müssen journalistisch vorsichtig sein und Trumps Äußerungen etwas abklingen lassen, bevor wir sie bewerten. Wohin orientieren sich die USA? „America First“ bedeutet nicht Rückzug, aber eine Neujustierung: Europa erhält Sicherheitsgarantien nicht kostenfrei. Die strategische Hinwendung nach Asien begann bereits unter Obama. Die Ukraine war lange interessant, um Russland zu schwächen – aber je stärker China wird, desto weniger dürfte der Konflikt im Fokus zu stehen, wenn er nicht direkt amerikanische Interessen berührt.
Ich möchte Trump nicht absprechen, den Frieden zu wollen – angesichts all der Toten. Ich halte es auch für bedeutsam zu fragen, warum die EU in fast vier Jahren Krieg keinen Friedensplan vorgelegt hat.
Ist der Westen – insbesondere die EU – Teil des Problems oder Teil der Lösung? Diese Frage stellt sich weil die Positionen in der EU sehr uneinheitlich sind.
Das erste Problem ist: Der Begriff „der Westen“ existiert so nicht mehr. USA und EU sind gespalten. Innerhalb der EU herrschen tiefe Differenzen darüber, wie die Ukraine zu gestalten und wie der Krieg zu beenden sei. Für manche Staaten ist es einfacher, die Ukrainer leiden, als Europäer sterben.
Innerhalb der EU existieren unterschiedliche Interessenlagen, wie sich etwa bei russischen Drohnenüberflügen oder moderner Waffentechnik zeigt. Die EU kann oft nicht mit hochgerüsteten Armeen wie Israel oder Russland mithalten – das gilt auch für einige NATO-Staaten. Der Status quo ist für viele EU-Länder interessant um Zeit zu gewinnen.
Ein wichtiges Instrument, ein Faustpfand, sind Sanktionen und das Einfrieren russischen Vermögens in der EU: Damit kann man Prozesse erschweren und verzögern. Die Zentrale Frage ist, welche Position die Ukraine in einer europäischen Sicherheitsarchitektur einnehmen wird, dazu zählt, was sind die Staaten der EU bereit zu geben und welche Option ist eine EU-Mitgliedschaft, wie steht es um wirkliche Sicherheitsgarantien.
Eine NATO-Mitgliedschaft erscheint derzeit ausgeschlossen – die USA wollen keine Garantien übernehmen. Ein EU-Beitritt ist politisch heiß umstritten – Ungarn sagt derzeit Nein, auch Bauern in Polen oder Frankreich sind dagegen. Es entsteht ein komplexes Netz divergierender Interessen.
Orbán hat meiner Ansicht nach Recht, wenn er sagt, dass die Ukraine den Krieg heute nicht militärisch gewinnen kann – im Sinne der Rückeroberung aller annektierten Gebiete.
Also ist das offizielle Ziel der Ukraine – Krim, Donbas zurückzuerobern – unrealistisch?
Weder ein Zusammenbruch Russlands noch der Ukraine erscheint gegenwärtig wahrscheinlich. Irgendwo muss man einen Kompromiss finden – Trump versuchte es, doch bisher ohne Erfolg.
Russlands hat vier Oblaste annektiert – wo bleibt dann die strategische Flexibilität? Wäre Vladimir Putin bereit diese Ansprüche teilweise aufzugeben?
Russland verfügt über ausreichend – ich formuliere das mal brutal – „Menschenmaterial“ um den Krieg fortzuführen. Die Ukraine kann zwar Russlands Energieinfrastruktur wie zuletzt deutlich treffen – doch dies hat bisher die Kriegsführung nicht maßgeblich gebremst.
Solange China, Nordkorea und Iran strategische Partner bleiben, die gegen ein bestehendes Weltordnungssystem agieren, bleibt es schwierig, Bewegung in diesen Konflikt zu bringen. Abzuwarten bleibt allerdings, ob das Treffen Trump-Putin in Budapest den Friedensprozess neue Impulse verleihen kann, sollte es in absehbarer Zeit stattfinden.
Ein entscheidender Punkt ist: Wenn Xi Jinping mit Putin spricht oder Trump mit Putin – wir Journalisten müssen erkennen, wie weit entfernt wir oft von solchen Entscheidungsprozessen sind. Der Alaska-Gipfel Trumps mit Putin etwa wurde medial voller Erwartung begrüßt – doch es ist nichts Substanzielles daraus entstanden.
In der Ukraine gibt es den Vorwurf, Ungarn unterstütze russische Interessen – etwa durch Energie, Propaganda oder Spionage. Was zeigen Ihre Recherchen?
Ungarn ist nicht mein primäres Fachgebiet. Ich erkenne aber, dass Ungarn das Problem benennt: die Unfähigkeit Europas, eine Friedensperspektive zu entwickeln. Ich weiß nicht, worauf die EU wartet.
Eine große Energieabhängigkeit Ungarns von Russland existiert – ebenso wirtschaftliche Verflechtungen mit China, gegeben durch zahlreiche Staatskredite. Dazu kommt ein Konflikt zwischen der eher links-liberalen Ausrichtung der EU und dem national-konservativen Modell Ungarns. Die Ukraine wird hier zu einem Brennpunkt.
Warum die Orbán-Regierung sich massiv gegen Beitrittsverhandlungen stellt, ist mir nicht klar. Das erste Verhandlungscluster wurde blockiert.
Zur Diskriminierung der Ungarn in Transkarpatien: Ich konnte in den vergangenen drei Jahren keine Diskriminierung feststellen. Viele Ungarn dort sprechen kein Ukrainisch – doch das Erlernen der Landessprache halte ich für ein Minimum, das von jedem Staatsbürger erwartet werden kann.
Die ungarische Regierung gibt sich gern als Schutzmacht der Magyaren in Transkarpatien.
Ich kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Solange die Sowjetunion bestand, war Russisch die Verkehrssprache – 30 Jahre sind jedoch vergangen, und ich sehe keine Unterdrückung der ungarischen Minderheit.
Sie berichten seit über 25 Jahren aus Kriegs- und Krisengebieten. Wie wirkt sich dieser Konflikt auf Sie persönlich aus? Nächstes Jahr gehen Sie voraussichtlich in Pension – ein emotionaler Moment.
Ich beschäftige mich intensiv mit der Ukraine seit 1991. Nach der Pension werde ich private Verpflichtungen angehen – vom Heustadl bis zur Bibliothek. Die Ukraine und der Balkan werden für mich jedoch nicht ad acta liegen. Ich werde vermutlich ein weiteres Buch schreiben und „meine“ Konfliktregionen im Blick behalten. Ich muss mich nicht mehr zu jeder Meldung äußern, aber wenn Medien mich zu Interviews oder Dokumentationen einladen – gerne.
Ich freue mich besonders darauf, mehr Zeit mit meiner Frau, meinen Töchtern und meiner Enkelin verbringen zu können. Ein ehemaliger ORF‑Generaldirektor sagte einmal: „Der Friedhof ist voller Unersetzlicher„, man sollte sich selbst nicht zu wichtigen nehmen. Natürlich bedeutet eine Personalentscheidung hunderte Programmentscheidungen – trotzdem ist es besser, dass Zuschauer, Zuseher und Zuhörer sagen: „Schade, dass er aufgehört hat“, als: „Schade, dass er seine Zeit nicht erkannt hat.“
Nochmal zurück zum Konflikt: Sehen Sie Spielräume für Verhandlungen – oder sind alle Brücken bereits zerstört? Wo können neue Brücken gebaut werden?
Ich glaube, Verhandlungsspielräume bestehen – denn ein klares, endgültiges Ende, bei dem eine Seite eindeutig gewinnt, ist derzeit nicht absehbar. Je länger der Krieg andauert, desto größer die Folgen -von Zerstörung bis Migration.
Darum wäre es dringend notwendig, rasch in Verhandlungen einzutreten. Das heißt nicht, dass sofort das Schießen aufhören würde – aber der Beginn diplomatischer Gespräche ist dringend wünschenswert.
Photo: Christian Wehrschütz auf der Wiener Buchmesse 2022, © C.Stadler/Bwag; CC-BY-SA-4.0.
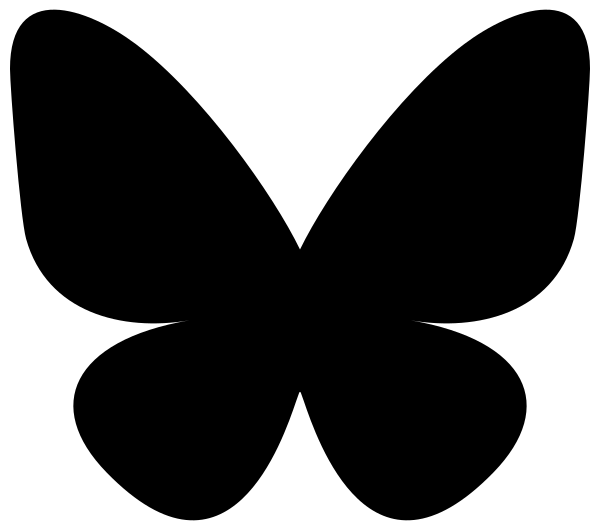




Deshalb setzt Orban auf Putin. Der verspricht, dass die Region „heim“ nach Ungarn zurückkehren werde. Russland will die die annektierten Oblaste und verspricht zugleich Polen und Ungarn polnische und ungarische Siedlungsbiete in der Ukraine, will die Ukrainische Regierung durch eine russlandfreundliche Regierung ersetzen, die Ukraine entwaffnen und die Kontrolle über die ukrainischen Bodenschätze erhalten. Deshalb spricht Putin auch vom Stellvertreterkrieg und ist nur bereit mit Trump zu verhandeln und einen Frieden „über“ und nicht „mit“ der Ukraine zu schließen. Die Europäer werden auch im Eigeninteresse keine derartigen Verhandlungen „über die Ukraine“ mit Russland führen. Trump hat dieses „no Go“ ignoriert. Zugleich versucht Trump die EU zu spalten: Er fordert sie auf den Bezug fossiler Energien aus Russland zu beenden, wohlwissend, dass sein Freund Orban die EU-Sanktionen in diesem Bereich torpediert. So kann sich Trump genüsslich zurücklehnen, keine Sanktionen gegen Russland in Kraft setzen, weil Orban die Einheit der Europäer verhindert.