Budapest/Belgrad. Trotz der jüngsten Verschärfungen der Russland-Sanktionen seitens der EU – darunter Preisdeckel auf russisches Erdöl und ein komplettes Verbot von Nord Stream – schreiten Ungarn und Serbien mit einem gemeinsamen Öl‑Pipelineprojekt voran. Die Leitung soll russisches Ural-Rohöl über Ungarn nach Serbien transportieren und ist weitgehend als strategischer Gegenschlag auf die Energiepolitik der EU zu verstehen.
Péter Szijjártó, ungarischer Außen- und Wirtschaftsminister, kündigte vergangene Woche an, der Bau könne bereits Ende 2025 oder Anfang 2026 beginnen. Ab 2028 soll der Betrieb voll anlaufen. Das Projekt umfasst laut Machbarkeitsstudie der MOL rund 180 km Pipeline in Ungarn und etwa 120 km in Serbien – mit einer jährlichen Kapazität von 4 bis 5 Millionen Barrel und Investitionskosten von rund 130 Milliarden Forint (ca. 350 Mio USD).
Die Pipeline soll Serbiens Abhängigkeit von derzeitigen Transitwegen, etwa dem kroatisch‑adratischen JANAF-System, verringern, das zunehmend durch US‑Sanktionen gegen die Naftna Industrija Srbije (NIS) bedroht ist. Bereits 2022 hatten Ungarn und Serbien eine Absichtserklärung getroffen, wonach russisches Öl künftig über die südliche Zweigstrecke der Druzhba („Freundschaft“) transportiert werden soll.
Kernpunkte der politischen und strategischen Bedeutung
- EU‑Sanktionen: Die EU hat mit dem 18. Sanktionspaket den Preisdeckel für russisches Öl auf 47,60 USD pro Barrel gesenkt, ein Verbot von Ölprodukten aus Drittstaaten eingeführt und Transaktionen rund um Nord Stream untersagt.
- Unabhängigkeit und Kostenargument: Szijjártó kritisierte, dass Brüsseler Entscheidungen zu höheren Energiepreisen führen würden. Die Pipeline wird als Mittel verteidigt, um „die Preise für Haushalte in Ungarn auf einem niedrigen Niveau zu halten“. Er bezeichnete das Vorhaben als „mutige und souveräne Entscheidung“.
- Regionale Solidarität: Ein zentraler Satz Szijjártós lautete: „Es gibt keine ungarische Energiesicherheit ohne Serbien – und keine serbische ohne Ungarn.“ Hintergrund ist die enge Kooperation, etwa über Gas, Strom und Infrastrukturprojekte wie die geplante Bahnverbindung Budapest–Belgrad.
- Widerstand in der EU: Die EU strebt eine vollständige Beendigung der russischen Gasimporte bis spätestens 2028 an. Ungarn und auch die Slowakei weigern sich bislang, diesen Kurs zu unterstützen, was den Einsatz alternativer Rechtsmittel und tarifpolitischer Maßnahmen provoziert. Analysten sehen in dieser Entwicklung einen wachsenden geopolitischen Graben zwischen der europäischen Zentralregierung und ihren süd-oesteuropäischen Außengrenzen.
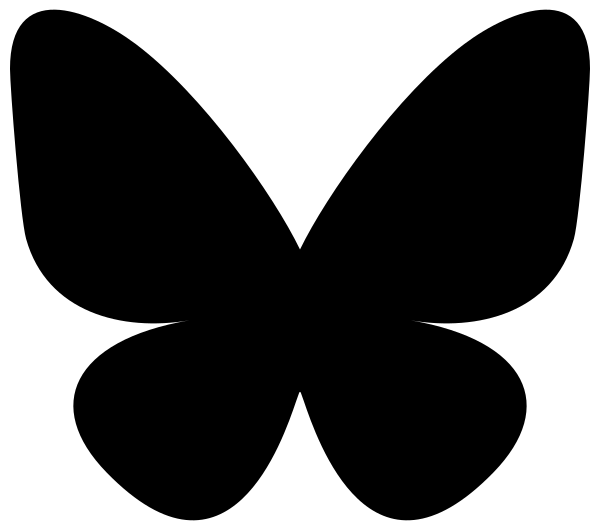




Gib den ersten Kommentar ab