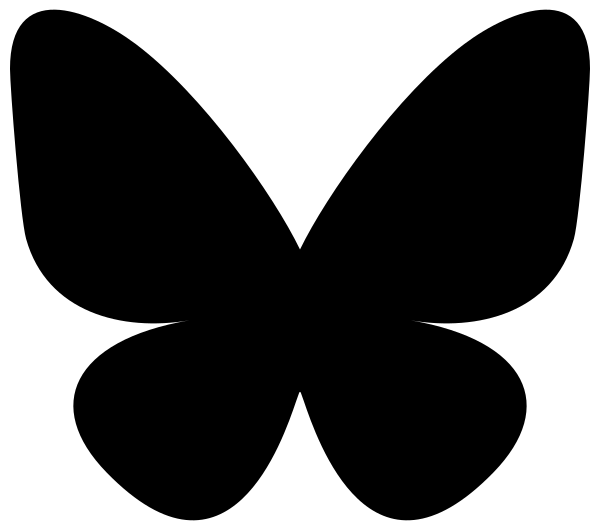Eine Wiener Veranstaltung beleuchtet die frühen deutschsprachigen Zugänge zu Sándor Petőfi – und öffnet den Blick auf eine kaum bekannte Phase gemeinsamer Kulturgeschichte
Wien. Die Erinnerung an Sándor Petőfi kreist in Ungarn meist um den revolutionären Märtyrer von 1848. Doch die deutschsprachige Rezeption des Dichters folgte lange Zeit einer eigenen Logik: getragen von ungarndeutschen Intellektuellen, beeinflusst von der politischen Atmosphäre des Vormärz und stark vernetzt in der Habsburgermonarchie. Eine Veranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Literatur widmet sich nun diesem frühen Kapitel – und zeigt, wie grenzüberschreitend Petőfi bereits zu Lebzeiten war.
Die Forschung von Margarete Wagner, die kommende Woche in Wien (20. November, Herrengasse 5) vorgestellt wird, rekonstruiert die Jahre zwischen 1845 und 1860 – jene Phase, in der Petőfis Gedichte in deutscher Fassung erstmals breitere Leserkreise erreichten. Nicht nur in Pest oder Debrecen, sondern ebenso in Wien, Pressburg, Brünn und in den deutschsprachigen Exilkreisen, die sich nach 1848 über Mitteleuropa und darüber hinaus zerstreuten.
Schon in der Vormärzzeit herrschte im Kaiserstaat ein ausgeprägtes Ungarn-Interesse. Es war eine Phase romantischer Faszination, in der das „ungarische Nationalkolorit“ zu einem kulturellen Motiv avancierte. Petőfi passte hervorragend in dieses Bild: ein Dichter mit klarer Stimme, politischem Impetus und einer bemerkenswerten stilistischen Modernität. Dass ungarndeutsche Literaten und Übersetzer seine Texte engagiert verbreiteten, war dabei kein Zufall. Sie verstanden sich als kulturelle Vermittler zwischen beiden Sprachwelten, angesiedelt in einem Raum, der weder eindeutig ungarisch noch eindeutig deutsch war, sondern beides zugleich.
Wagners Analyse zeigt, wie sich die frühen Übersetzungen in diesem Spannungsfeld bewegten. Sie machten Petőfi für ein österreichisches Publikum lesbar, ohne den politischen Kern seiner Texte vollständig zu entschärfen. Die Revolution von 1848 änderte vieles: Aus literarischem Interesse wurde ein politisches Signal. Die ungarische Erhebung fand – gerade im liberalen Milieu Wiens – aufmerksame Leser, und mit ihr gewann auch Petőfis Werk an symbolischer Bedeutung. Seine Texte wurden Teil einer europaweiten Debatte über Freiheit, Nationalbewusstsein und politische Teilhabe.
Im Rückblick ist diese deutschsprachige Petőfi-Rezeption ein bemerkenswertes kulturhistorisches Dokument. Sie erinnert daran, dass die kulturellen Beziehungen zwischen Wien und Budapest stets enger waren, als es heutige politische Linien vermuten lassen. Und sie zeigt, dass Petőfi nicht nur der ungarischen Literatur gehört, sondern einem größeren, mitteleuropäischen Raum, der seine Stimmen und Traditionen bis heute miteinander verwebt.
Die Veranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Literatur greift diesen Faden auf. Am Donnerstag, dem 20. November, präsentiert Margarete Wagner ihre Forschung in der Herrengasse 5. Der Abend ist Teil einer Reihe, die literarische und historische Perspektiven verbindet und den Blick für die gemeinsame kulturelle Geschichte des heutigen Österreich und Ungarn schärft. Ein angemessener Rahmen für einen Dichter, dessen Wirkung weit über nationale Grenzen hinausreichte.
Quellen: Österreichische Gesellschaft für Literatur, Franz Grillparzer Gesellschaft
Photo: Porträtbüste Sándor Petőfi, CC-ASA 4.0 Pasztilla aka Attila Terbócs, Wikicommons