Budapest. Während landesweite Umfragen der Tisza-Partei von Péter Magyar einen steten Vorsprung gegenüber Fidesz bescheinigen, setzt Viktor Orbáns Regierung alle Mittel ein, um die drohende Niederlage bei der Wahl 2026 in einen Sieg umzuwandeln. Manipulierte Wahlkreise, zweifelhafte Umfragen und die Inszenierung wirtschaftspolitischer Schreckensszenarien sollen das Bild einer unveränderten Dominanz der Regierungspartei zeichnen.
Nationaler Trend gegen Orbán
Seit den Europawahlen im Juni 2024 zeigen fast alle unabhängigen Institute einen klaren Abwärtstrend für Fidesz. Der Rückstand gegenüber Tisza liegt zwischen sieben und fünfzehn Prozentpunkten. Nur regierungsnahe Institute wie Századvég und Nézőpont weichen ab. Századvég verstummte im Herbst 2024 und veröffentlichte seither keine Parteipräferenzumfragen mehr, während Nézőpont im Sommer 2025 überraschend einen angeblichen Vorsprung von zwölf Prozent für Fidesz präsentierte.
Die gleichzeitigen Angriffe auf unabhängige Institute, orchestriert durch prominente Regierungsakteure und flankiert vom neu geschaffenen Amt für den Schutz der Souveränität, zeigen den Stellenwert von Umfragen als politischem Instrument. Orbán selbst verwies zuletzt auf interne Erhebungen, die Fidesz sichere Mehrheiten in 80 von 106 Direktwahlkreisen prognostizierten.
Denken Sie dass es bei den Parlamentswahlen im Frühjahr 2026 zu einem Regierungswechsel in Ungarn kommt?
- Ja (48%, 30 Stimmen)
- Wahrscheinlich Ja (24%, 15 Stimmen)
- Nein (11%, 7 Stimmen)
- Ungewiss (11%, 7 Stimmen)
- Wahrscheinlich Nein (5%, 3 Stimmen)
Wähler insgesamt: 62
Index als Lautsprecher der Macht
Für Aufsehen sorgte eine Reihe angeblich „durchgesickerter“ Umfragen, die das regierungsnahe Portal Index.hu veröffentlichte. Dort zeichnet sich ein Bild starker Fidesz-Dominanz in vielen Wahlkreisen – jedoch mit auffälligen Widersprüchen. Während Fidesz in ländlichen Bezirken teils zweistellige Verluste verbuchen soll, bleibt der Abstand zur Opposition insgesamt nahezu ident. In anderen Gegenden werden Zugewinne für kleinere Parteien wie die LMP ausgewiesen, die seit längerem eher keine Rolle spielen.
Analysen unabhängiger Wahlforscher legen nahe, dass diese Ergebnisse Teil einer strategischen Desinformationskampagne sind: Wo Tisza bereits stark ist, wird der Abstand kleingerechnet; wo Fidesz dominiert, werden scheinbare Aufholjagden inszeniert, die dann zu knappen, aber siegreichen Rennen führen sollen. Eine Mobilisierung der Stammwähler.
Gerrymandering als Sicherheitsnetz
Der Schlüssel zur Macht liegt nicht im landesweiten Stimmenanteil, sondern in den Direktwahlkreisen. Das ungarische Wahlrecht ist so zugeschnitten, dass selbst bei einem landesweiten Rückstand von fünf Prozentpunkten Fidesz noch eine Parlamentsmehrheit erreichen könnte. András Pulai vom Institut Publicus rechnet vor, dass Tisza mindestens sechs Prozentpunkte Vorsprung benötigt, um die strukturellen Nachteile zu überwinden.
Hinzu kommt die Option weiterer kurzfristiger Wahlgesetzänderungrn. Schon 2021, ein halbes Jahr vor der letzten Parlamentswahl, passte Fidesz die Regeln zu eigenen Gunsten an. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass auch 2026 erneut Änderungen vorgenommen werden.
Den bisher größten Gerrymander gab es 2011.
Tisza als neue Sammlungsbewegung
Die Stärke der neuen Partei liegt nach Einschätzung von Pulai darin, unterschiedliche Milieus anzusprechen: einerseits urbane Wähler, die auf Demokratie und Bürgerrechte setzen, andererseits die traditionell-national populistisch orientierten Gruppen, die zuvor beim rechtsextremen Jobbik beheimatet war. In den Regionen, in denen Jobbik in den 2010er Jahren stark war, hat Tisza heute ihre besten Prognosen.
Ein Nachteil bleibt jedoch: Während Fidesz auf erfahrene Mandatsträger zurückgreift, will Tisza ausschließlich neue Gesichter nominieren. Damit soll eine klare Abgrenzung von den diskreditierten Altparteien gelingen, doch ob politische Unerfahrene in ihren Wahlkreisen überzeugt, bleibt offen.
Propaganda über Steuerpolitik
Parallel zur Debatte über Umfragen projeziert die Regierung ihre Kommunikationsmacht gegen Tisza. Regierungsminister Gergely Gulyás warnte über die staatliche Nachrichtenagentur MTI vor einem angeblichen „brutalen Steuerplan“ der Opposition. Grundlage ist ein „Memo“, das angeblich interne Pläne für eine Rückkehr zu progressiven Einkommensteuern belegen soll.
Laut Gulyás müsste ein durchschnittlicher Arbeitnehmer künftig 300.000 Forint mehr Steuern pro Jahr zahlen, ein Lehrer-Ehepaar gar über 700.000 Forint. Für Doppelverdiener mit Hochschulabschluss rechnete er eine Belastung von 1,3 Millionen Forint vor. Die Vorlage stamme, so der Minister, aus dem „Geist der Gyurcsány-Ära“ und beweise eine künftige Allianz zwischen Tisza und der Demokratischen Koalition.
Unabhängige Bestätigungen dieser Angaben gibt es naturgemäß nicht. Die Kampagne reiht sich ein in die bekannte Regierungsstrategie, der Opposition finanzpolitische Inkompetenz und Bedrohung für die „kleinen Leute“ zu unterstellen.
Finale im Frühjahr 2026
Zwei Trends zeichnen sich ab: Orbán verliert kontinuierlich an Zustimmung, doch die institutionellen Rahmenbedingungen verschaffen ihm weiterhin strukturelle Vorteile. Umfragen sind dabei wichtiger Bestandteil des politischen Kampfes. Die Regierung rüstet rhetorisch auf, indem sie Steuerängste schürt und die Opposition in die Nähe des verhassten ehemaligen Premiers Gyurcsány rückt.
Ob Tisza die zahlreichen Hürden der Wahlkreise überspringen kann, hängt nicht allein vom landesweiten Vorsprung ab. Entscheidend wird, ob es der neuen Partei gelingt, ihre lokale Basis zu konsolidieren und Kandidaten aufzustellen, die Orbáns Apparat in den eigenen Bastionen ernsthaft gefährden können.
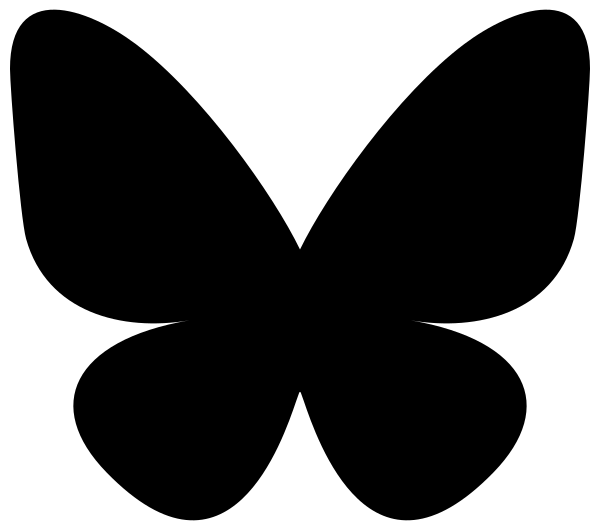




Gib den ersten Kommentar ab