Finanzkonflikt zwischen Hauptstadt und Regierung – Karácsony fordert Verhandlungen nach richterlicher Bestätigung der Verfassungswidrigkeit
Budapest. Die juristische Auseinandersetzung um die umstrittene „Solidaritätsabgabe“, die Budapest jährlich in Milliardenhöhe an den Staatshaushalt abführen muss, erreicht eine neue Phase: Das Budapester Berufungsgericht hat in einem Urteil die Position der Hauptstadt bestätigt und die Abgabe als verfassungsrechtlich zweifelhaft eingestuft. Zugleich verwies das Gericht die Angelegenheit erneut an das Verfassungsgericht – eine Wiederholung, die den politischen Druck auf die Regierung Orbán erhöht, jedoch kaum konkrete Folgen erwarten lässt.
Politisch erzeugtes chronisch strukturelles Defizit
Die sogenannte Solidaritätsabgabe (ungarisch: szolidaritási hozzájárulás) wurde im Zuge der Neuordnung kommunaler Finanzen eingeführt und belastet vor allem wirtschaftsstarke Kommunen, allen voran Budapest. Unter dem Vorwand finanzieller Ausgleichsmechanismen werden beträchtliche Summen aus den Stadthaushalten entnommen und zentral über die Regierung „umverteilt“. Im Fall Budapests handelt es sich laut Magistrat um jährlich rund 58 Milliarden Forint (~147,5 Millionen Euro), ein Betrag, der nicht nur Haushaltsplanungen erheblich erschwert, sondern gezielt Investitionsspielräume einschränkt.
Bürgermeister Gergely Karácsony warf der Regierung am Dienstag vor, diese Praxis diene nicht dem Ausgleich, sondern der gezielten politischen Schwächung der Opposition. Die Budapester Stadtregierung werde „strukturell ausgehungert“, während gleichzeitig gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben in voller Verantwortung bei der Kommune verblieben: In guten Jahren soll Budapest mit weniger Geld mehr Leistung erbringen, in schlechten Jahren fehlt das Geld doppelt.
Gericht bestätigt Rechtsauffassung der Hauptstadt
Wie Karácsony auf einer Pressekonferenz mitteilte, habe das Fővárosi Ítélőtábla (Berufungsgericht der Hauptstadt) festgestellt, dass die gesetzlich geregelte Abgabe dem Geist und Wortlaut des ungarischen Grundgesetzes (Alaptörvény) widerspricht. Damit sei die zentrale These der Stadtverwaltung bestätigt worden: Die Zwangsabgabe untergräbt die kommunale Selbstverwaltung, ein in der Verfassung verankerter Grundsatz.
Da ordentliche Gerichte keine Gesetzesnormen aufheben dürfen, wurde die Frage zum zweiten Mal dem Verfassungsgericht (Alkotmánybíróság) vorgelegt. Ein früheres Urteil hatte bereits Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme erkennen lassen, jedoch ohne rechtlich bindende Konsequenzen für die Regierung.
Auch der Staatliche Rechnungshof (Állami Számvevőszék) habe laut Karácsony in einem internen Bericht die Belastungen für Budapest als überhöht und finanziell destruktiv bezeichnet – ein seltenes Eingeständnis aus einer Institution, die in der Regel linientreu agiert.
Karácsony: „Verhandlungen alternativlos“
Angesichts der stockenden rechtlichen Verfahren und der bevorstehenden Haushaltsverhandlungen für 2025 sieht sich die Stadtverwaltung nun gezwungen, den Dialog mit der Regierung zu suchen. „Es bleibt keine Zeit für weitere gerichtliche Auseinandersetzungen“, so Karácsony. Die Metropolregion lade die Regierung daher „an den Verhandlungstisch“, um eine politische Lösung für die aus ihrer Sicht verfassungswidrige Abgabe zu finden.
Die Erfolgsaussichten erscheinen jedoch gering. Schon in der Vergangenheit hatte das Kabinett Orbán Gerichtsurteile ignoriert oder durch nachträgliche Gesetzesänderungen neutralisiert. Auch das Verfassungsgericht ist seit Jahren personell und institutionell eng mit der Regierungspartei Fidesz verflochten. Eine Entscheidung gegen die Abgabe wäre politisch spektakulär und juristisch überraschend.
Systematische Entmachtung der Städte
Der Fall ist Teil eines größeren Trends, in dem die ungarische Regierung seit Jahren gezielt autonome Strukturen auf lokaler Ebene abbaut. Besonders betroffen sind Städte mit oppositionellen Mehrheiten: Budapest, Szeged, Pécs, Miskolc.
Gleichzeitig nutzt die Regierung EU-Fördermittel gezielt an den Kommunen vorbei, indem Mittel direkt an regierungstreue Organisationen oder die Komitatsverwaltungen geleitet werden. Damit wird der finanzielle Spielraum der Städte nicht nur reduziert, sondern aktiv umgangen.
Ist das noch Rechtsstaat?
Die Solidaritätsabgabe ist ein Gradmesser für den Zustand des ungarischen Rechtsstaats.
Dass die Budapester Stadtregierung sich trotz begrenzter Erfolgsaussichten auf den Rechtsweg begibt, hat vor allem Symbolcharakter. Der Budapester Bürgermeister will damit vorallem zeigen, dass man sich nicht komplett wilkürlich auf der Nase herumtanzen lässt, dass ein Rechtsstaat, wenn auch untergraben, noch existiert und es sich lohnt Mittel auszuschöpfen – auch wenn die Aussichten gering sind – trotz relativ klarer juristischer Lage zugunsten Budapests.
Der ungarische Wirtschaftsminister Nagy Márton wies die Kritik Karácsonys in einer prompten Reaktion scharf zurück. Die Solidaritätsabgabe sei „ein gerechtes, verfassungsmäßig einwandfreies Instrument“, das dem fiskalischen Ausgleich zwischen wirtschaftlich ungleichen Regionen diene. Karácsonys Darstellung bezeichnete er als „populistisch und irreführend“. Der Minister betonte, dass sich Budapest trotz der Abgabe weiterhin in einer privilegierten Einnahmeposition befinde.
Nagy ließ offen, ob die Regierung das Urteil des Berufungsgerichts zum Anlass für inhaltliche Nachverhandlungen nehmen werde. Der Ton der Stellungnahme deutet nach Interpretation des PL darauf hin, dass Budapest auch weiterhin mit wenig bis keinem Entgegenkommen der Regierung rechnen darf.
Quelle: MTI.hu, Infostart.hu
Titelbild: Karacśony 2021, Photo von SZERVÁC Attila
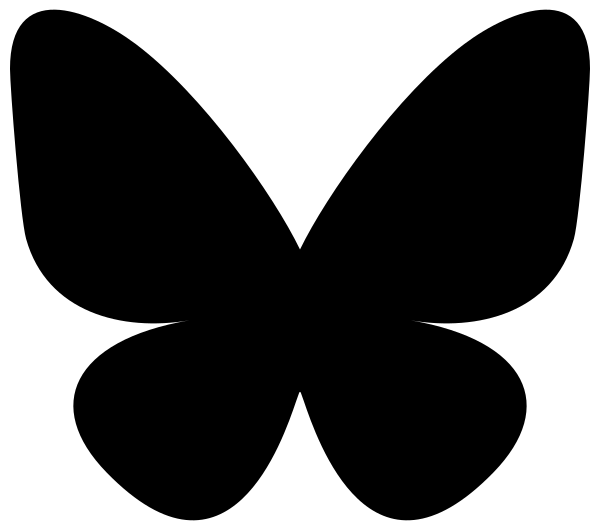




Gib den ersten Kommentar ab