Auf dem nationalen Feiertag versammelt sich Ungarn nicht zu einer Debatte über sozioökonomische Herausforderungen Im Land – sondern im symbolischen Machtkampf „Wir gegen Brüssel“
Budapest. Am 23. Oktober, dem Gedenktag an den Aufstand von 1956, wurde das Land Zeuge eines doppelten Spektakels: Einerseits eines historisch aufgeladenen Aufmarschs der Regierung auf dem Kossuth-Platz, getragen von pathospflichtiger Selbstinszenierung. Andererseits einer beeindruckenden Gegendemonstration, organisiert von der TISZA-Partei, die sich als neues Zentrum der Opposition in Stellung bringt. Doch statt politischer Debatte um die miserablen Zustände in Ungarn – sei es in Bildung, Gesundheit, Wirtschaft oder Infrastruktur – stand einmal mehr der große Kulturkampf im Mittelpunkt – ein orchestriertes Drama, in dem Orbáns Regierung sich selbst zum letzten Bollwerk gegen Krieg, Migration und moralischen Verfall erklärt. Eine beeindruckende Nebelgranate um von jeder Verwantwortung über 15 Jahre Regentschaft der Fidesz abzulenken. Schuld sind die anderen – niemals die absolutistisch agierende Regierung.
Die Kundgebungen analytisch betrachtet
Die Zahl der Teilnehmer wurde von der regierungsnahen Presse schnell zugunsten des sogenannten Friedensmarschs ausgelegt – doch unabhängig erhobene Schätzungen sprechen eine andere Sprache: Laut Zählung der ETEL-Universität marschierten etwa 160.000 Menschen mit dem Oppositionslager, während der Regierungsaufmarsch rund 90.000 erreichte.

Viktor Orbán sprach, wie gewohnt, von einer existenziellen Bedrohung. Er stellte die Wahl zwischen Krieg und Frieden, zwischen Brüssel und Ungarn. Dass er dabei ein Bild von Europa als belagernder Macht entwirft, in dem Ungarn allein für Vernunft und Zurückhaltung stehe, gehört zum gewohnten Repertoire.
„Diejenigen welche die Regierung stürzen wollen unterstüzten den Krieg“
erklärte er auf dem Kossuth-Platz, flankiert von Tausenden, die die ungarische Fahne schwenkten. Wer gegen die Regierung sei, unterstütze auch höhere Steuern, das Ende von Preisdeckeln, Familienförderung und -so die neueste Wendung – den Tod der nationalen Souveränität.
Péter Magyar, der Oppositionsführer der TISZA-Partei, setzte auf eine andere Sprache. Er erinnerte an Orbáns eigene Vergangenheit, an dessen berühmte Rede 1989, in der er den Abzug der sowjetischen Truppen forderte. Nun aber, so Magyar, sei aus dem jungen Systemkritiker der loyalste Statthalter des Kremls in Europa geworden. „36 Jahre später“, sagte Magyar:
„sind sie so verängstigt, dass sie uns nicht einmal auf den Stufen der Kunsthalle reden lassen.“
Tatsächlich sprach vieles für einen Bruch mit den ritualisierten Auftritten vergangener Jahre. Die TISZA-Kundgebung setzte auf Authentizität und Inszenierung zugleich: brennende Autowracks, Knallgeräusche, alte Radiomitschnitte – das historische Referenzbild von 1956 wurde mit dramaturgischer Wucht aufgeladen. Und doch war es nicht Vergangenheit, die beschworen wurde, sondern Zukunft: Magyar versprach nicht weniger als eine politische Zeitenwende in 170 Tagen, dem geplanten Wahltermin am 12. April 2026.
Kampfbegriffe statt Realität
Die Inszenierung der Regierung folgte einem bekannten Muster – und hat sich doch weiter radikalisiert. Der „Krieg“ ist nicht nur der in der Ukraine. Es ist ein Kulturkrieg gegen Brüssel, gegen Migration, gegen „Genderideologie“, gegen alles, was nicht in das Weltbild einer nationalistisch‑autoritären Regierung passt.
„Wir sind das einzige migrantfreie Land in Europa“
erklärte Orbán stolz. Und fügte hinzu:
„Wir verteidigen die Kinder vor LGBTQ-Aktivisten, wir halten das Brüsseler Gift fern.“
Solche Sätze sind keine rhetorischen Entgleisungen, sondern strategische Markierungen. Dabei bleiben zentrale innenpolitische Herausforderungen ausgeblendet: marode Krankenhäuser, fehlende Lehrer, defizitäre Kommunalhaushalte, eine Inflation, die Löhne und Renten auffrisst. Die Politik der Konfrontation lebt von der Verdrängung des Alltags.
Dass EU-Mittel weiterhin in dubiosen Kanälen verschwinden, etwa über manipulierte Ausschreibungen an oligarchennahe Firmen wie die von Lőrinc Mészáros, tauchte in Orbáns Rede ebenso wenig auf wie die Frage, weshalb ungarische Infrastrukturprojekte oft doppelt so teuer ausfallen wie vergleichbare Bauvorhaben in Westeuropa. Der investigative Abgeordnete Ákos Hadházy erklärte unlängst im Interview mit dem Pester Lloyd, dass selbst der private Wohnsitz Orbáns in Hatvanpuszta letztlich über EU-Subventionen mitfinanziert worden sei – über eine Kette von Aufträgen, Günstlingen und aufgeblasenen Preisen.
Ein Feindbild namens Europa
Je näher die Wahlen rücken, desto klarer zeigt sich die Stoßrichtung der Regierungskommunikation: Nicht das ungarische Modell steht zur Debatte, sondern Europas Zukunft. Orbán inszeniert sich als letzte Bastion des gesunden Menschenverstands – unterstützt, wie er betonte, von Trump, Salvini und „einem wachsenden Teil Europas, der den Frieden will“ – als ob Frieden eine rechtsnationale Eigenschaft wäre.
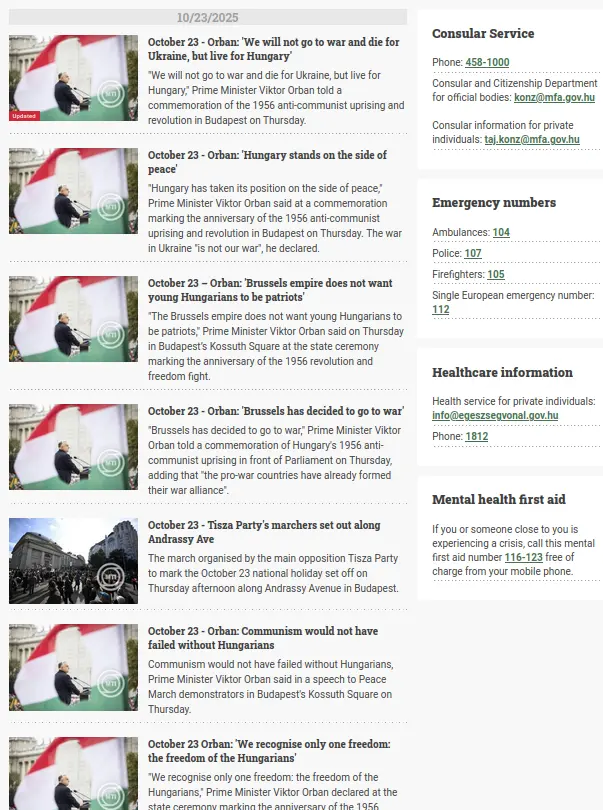
In seiner Logik sind alle, die gegen ihn stehen, Teil eines „Kriegsbündnisses“. Die EU sei nicht Vermittler, sondern Partei im Ukrainekrieg. Dass niemand – weder in Brüssel noch in Berlin oder Paris – von Ungarn verlangt, zur Kriegspartei zu werden, spielt keine Rolle. Der Strohmann funktioniert.
Orbán sagte:
„Die EU will uns zwingen, Ukraine aufzunehmen – dann wird der Krieg unser Krieg. Sie wollen unser Geld, unsere Waffen, unsere Söhne.“
Dazu passt die Bildsprache der Regierungsplakate, die dieser Tage in ganz Budapest hängen: Volodymyr Zelensky und Péter Magyar nebeneinander, Europa als Kriegsmaschine, Ungarn als letztes Refugium. Laut Hadházy ist diese Propaganda durch rund 400 Millionen Euro pro Jahr möglich – über 40€ pro Ungar im Jahr, nur für das Framing der Opposition als Landesverräter.
Budapest, Hauptstadt des Widerstands?
Bürgermeister Gergely Karácsony hielt sich in seiner Rede an die republikanische Tradition. Er erinnerte daran, dass am 23. Oktober nicht nur die Revolution von 1956 begann, sondern auch 1989 die Dritte Republik ausgerufen wurde – jene Staatsform, die heute aus dem Landesnamen gelöscht wurde. „Die Republik lebt im Untergrund weiter“, sagte Karácsony.
Magyars und Karácsonys Reden richteten sich gegen dasselbe Phänomen: Eine Regierung, die aus der Erinnerung eine Waffe gemacht hat, aus der Geschichte ein Machtinstrument, aus der Demokratie ein Werkzeug der Exklusion.
Der 23. Oktober als Spiegel
Was also bleibt von diesem Nationalfeiertag? Sicher ist: Er wurde von der Regierung zu einem Tag der Disziplinierung umfunktioniert. Wer Fragen stellt, gilt als illoyal. Wer Alternativen vorschlägt, als fremdgesteuert.
Doch die Straße beginnt sich zu bewegen. 160.000 Menschen, die sich mit einem neuen politischen Projekt identifizieren, sind kein Betriebsunfall. Noch mag Orbán den Apparat beherrschen. Aber sein Schattenreich ist nicht mehr unangefochten.
Quellen: MTI.hu, Interview mit Ákos Hadházy (Pester Lloyd), Transparency International
Photo: Viktor Orbán am 23. Oktober in Budapest, MTI/Hungarian PM’s General Department of Communication/Akos Kaiser
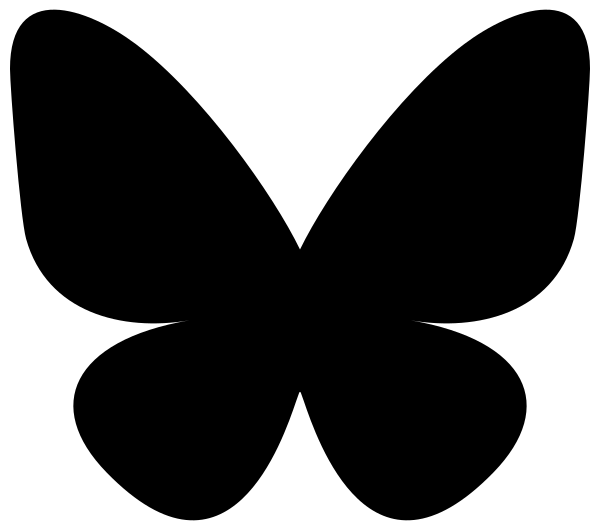




Gib den ersten Kommentar ab