Mitten in der haushaltspolitischen Schieflage Ungarns kündigt Premier Orbán einen neuen Fixzins-Kredit für KMU an – scheinbar wirtschaftsfreundlich, in Wahrheit ein fiskalisch riskantes Wahlkampfmanöver mit hoher Missbrauchsanfälligkeit.
Budapest. Mit einem Mix aus wirtschaftspolitischer Pompöser Rhetorik und realer Staatsintervention kündigte Viktor Orbán am 4. Oktober einen Fixzinskredit über die sogenannte Széchenyi-Karte für ungarische Klein- und Mittelunternehmen (KMU) an. Ab dem 6. Oktober sollen diese Darlehen zu 3 Prozent Zinsen und bis zu 150 Millionen Forint pro Firma bereitstehen. Die Maßnahme wird offiziell als Unterstützung für die krisengebeutelte Wirtschaft verkauft – sie ist jedoch in vielerlei Hinsicht problematisch: fiskalisch kaum tragbar, marktverzerrend, rechtlich fragwürdig und potenziell korruptionsfördernd.
Die Széchenyi Kártya ist ein seit 2002 existierendes staatlich gestütztes Kreditinstrument, das ursprünglich KMU den Zugang zu Betriebsmittelkrediten erleichtern sollte. Über die Jahre wurde sie unter wechselnden Namen ( Széchenyi GO! oder Széchenyi MAX) kontinuierlich ausgebaut. Die Abwicklung erfolgt über ein Netzwerk staatlich eingebundener Banken, insbesondere die staatliche Entwicklungsbank MFB und KAVOSZ Zrt., wobei der Staat die Zinslast teilweise oder vollständig übernimmt. Die Karte gilt inzwischen als eines der zentralen Instrumente ungarischer Wirtschaftsförderung – und als eines der intransparentesten.
Wahlkampfgeschenke
Begleitet von der Budapester Handelskammer präsentierte Orbán nun sein „zweites Säulenprojekt“ – neben vergünstigten Wohnungskrediten und Steuererleichterungen für Familien. Das neue KMU-Programm soll laut ihm unbürokratisch, frei verwendbar und ohne Risiko für Unternehmer sein. Die Realität: Es handelt sich um einen massiven, vom Staat finanzierten Zinszuschuss, der angesichts des aktuellen Marktumfelds (SME-Kreditkosten bei rund 8 bis 10 Prozent) einen direkten fiskalischen Aufwand erzeugt.
Die Zahlen nennt Orbán selbst: 250 Milliarden Forint für 2025 und 320 Milliarden für 2026, davon 60 Milliarden für das neue Fixzinsmodell – insgesamt ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag in Euro, jährlich. Diese Mittel kommen nicht von der Ungarischen Nationalbank, sondern aus dem Staatsbudget. Wohlweislich zu einer Zeit, in der der Haushalt bereits ein Defizit von über 5 Prozent des BIP aufweist.
De facto also eine indirekte staatliche Unternehmenssubvention, ausgezahlt ausgerechnet im Wahljahr. Die Maßnahme stützt kurzfristig die Nachfrage, verdrängt aber private Kreditvergabe, entzieht Banken Marktpotenzial und schafft gefährliche Anreizstrukturen. Strukturreformen werden damit nicht gefördert, sondern verschleppt.
EU-Rechtliche Bedenken
Die Maßnahme könnte auch juristische Konsequenzen auf europäischer Ebene nach sich ziehen. Nach Artikel 107 AEUV gelten gezielte Subventionen grundsätzlich als genehmigungspflichtige Beihilfen, sofern sie den Wettbewerb oder Handel innerhalb der EU verfälschen. Zwar erlaubt die de-minimis-Verordnung Beihilfen unter 200.000 Euro innerhalb von drei Jahren, doch viele Unternehmen dürften diese Schwelle überschreiten.
Bisherige Széchenyi-Programme wurden meist im Rahmen genehmigter staatlicher Beihilferegelungen bei der EU-Kommission angemeldet und akzeptiert, insbesondere im Zuge der COVID-Krise. Eine Erweiterung oder Wiederaufnahme ohne Neuanmeldung könnte ein Vertragsverletzungsverfahren auslösen. Brüssel hat in der Vergangenheit bei ähnlichen Fällen Zurückhaltung geübt – vor allem, weil auch westliche Staaten wie Deutschland oder Italien eigene Förderinstrumente nutzten. Dennoch bleibt das Risiko einer EU-rechtlichen Intervention – insbesondere wenn sich politische Diskriminierung oder Missbrauchsstrukturen nachweisen lassen.
Der wohl kritischste Aspekt des Orbán’schen Fördermodells ist seine Anfälligkeit für politisch motivierte Vergabepraktiken. Die operative Umsetzung erfolgt über KAVOSZ Zrt. und die MFB – zwei Institutionen, deren Nähe zu Fidesz-nahen Geschäftsinteressen gut dokumentiert ist. Schon in der Vergangenheit fielen ähnliche Programme durch mangelnde Transparenz, bevorzugte Vergaben und unzureichende Kontrollmechanismen auf.
Ein zinsbegünstigtes Darlehen ohne inhaltliche Zweckbindung, wie Orbán es anpreist, ist geradezu prädestiniert für Missbrauch:
– Scheinunternehmen und Briefkastenfirmen
– Überbewertete Investitionen mit geringen Realwerten
– Finanzierung von Projekten, die parteinahen Bau- und Beratungsfirmen zugutekommen
Die staatlich garantierte Bonität macht es zudem einfach, diese Mittel in Projekte umzuleiten, die der Regierungspartei politisch nützen, etwa in Wahlkreise, in denen Fidesz mit Gegenwind rechnet, oder zur Stabilisierung wirtschaftsnaher Netzwerke.
Subventionen auf Kosten der Allgemeinheit im Wahlkampf
Die zeitliche Platzierung des Programms könnte kaum mehr nach Wahlkampf schreien. Die sukzessive Freigabe von Wohltaten – von Steuererleichterungen über Familienboni bis hin zu Pensionsgutscheinen – folgt keiner konjunkturpolitischen Notwendigkeit sondern ausschließlich dem Wahlkalender. Die Verzögerung von Maßnahmen auf den Herbst wird durch angeblich geänderte internationale Umstände begründet – in Wahrheit zielt sie auf eine maximale psychologische Wirkung kurz vor der Wahl 2026.
In der auf MTI.hu geschalteten Aussendung zieht Orbán gleichzeitig die Opposition in den Schmutz, unterstellt, wie jüngst regelmäßig, der Tisza-Partei geplante Steuererhöhungen, Spitalschließungen und „Auslieferung der Landwirtschaft an die Ukrainer“.
Also ein politisch motiviertes Transferprogramm: Geld aus dem Staatshaushalt wird zu Wahlkampfzwecken umverteilt – unter dem Deckmantel der Krisenbewältigung. Es wird in Kauf genommen dass der Haushalt weiter ins Defizit rutscht, dass Marktmechanismen verzerrt und private Investitionen verdrängt werden, dass das Vertrauen in ein faires Fördersystem weiter erodiert.
„Wir senken die Zinssätze auf alle Kreditprodukte der Széchenyi-Karte auf drei Prozent – das ist eine riesige Hilfe für ungarische Unternehmen.„
– Viktor Orbán am 4. Oktober 2025
Redaktionelle Anmerkung: Eine detaillierte Analyse der rechtlichen Fallstricke im Beihilferecht der EU und der möglichen politischen Gegenreaktionen aus Brüssel werden wir bald genauer beleuchten. Für Hinweise auf konkrete Fälle von Missbrauch oder bevorzugter Kreditvergabe in diesem neuen Rahmen sind wir sehr dankbar. Schreiben Sie uns anonym an [email protected].
Quellen: MTI.hu, Wikipedia
Photo: Magyar Nemzeti Bank via Wikicommons
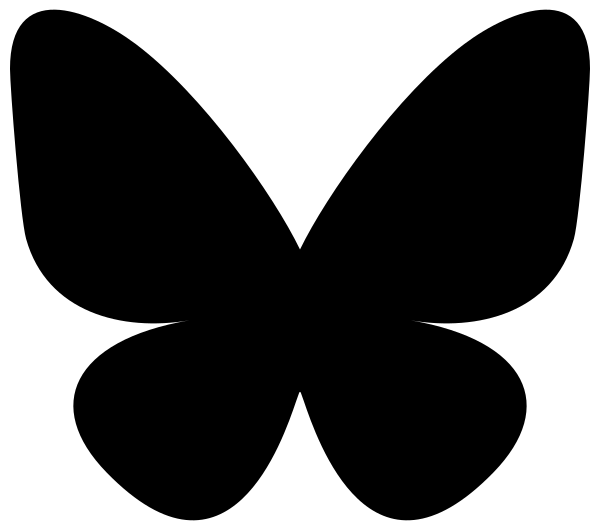




Gib den ersten Kommentar ab