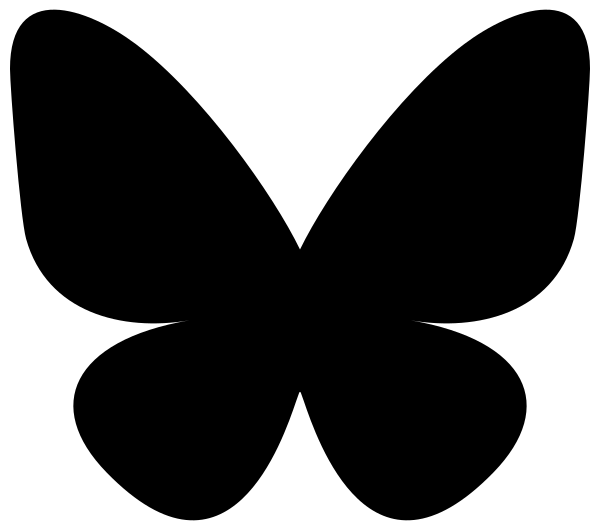Brüssel/Belém. Ohne die Vereinigten Staaten übernimmt die Europäische Union eine neue Rolle in der globalen Klimapolitik. Sie hat dabei mit innerem Widerspruch und externem Glaubswürdigkeitsverlusten zu kämpfen.
An den Ufern des Amazonas im brasilianischen Belém trifft sich die Weltgemeinschaft zur 2025 United Nations Climate Change Conference (COP30). Die EU steht im Rampenlicht – weil sich ihr traditioneller Partner, die Vereinigten Staaten, fernhält. Doch die Vorbereitung der Europäer ist alles andere als souverän verlaufen: Politische Uneinigkeit, verwässerte Ziele und ein Mitglied mit Hang zur Blockade – Ungarn – werfen Fragen nach der Durchsetzungsfähigkeit der Union auf.
Vom „guten Polizisten“ zum Alleinvertreter
Seit Jahren fungierten die USA im globalen Klimaprozess als Stoßtrupp oder Dialogpartner – nun gilt: Beim COP30 fehlt Washingtons Mitwirkungsbereitschaft. Gleichzeitig sieht sich die EU mit neuen Ansprüchen konfrontiert: Sie soll nicht nur ihre eigenen Klimaziele verschärfen, sondern auch andere Staaten wie China und Indien in die Pflicht nehmen. Der Kommissar für Klima, Wopke Hoekstra, erklärte dazu: „We are doubling down on that leadership role.“ Doch die Praxis erweist sich als nicht rosig: Die EU selbst hat jüngst ihre eigenen Klimaziele deutlich heruntergeschraubt.
Innere Zerreißprobe
Kurz vor COP30 einigten sich die Mitgliedstaaten auf eine EU-Position, die ein Netto-Reduktionsziel von 90 Prozent bis 2040 vorsieht – allerdings mit Flexibilitäten, etwa der Zulassung internationaler CO₂-Kredite. Kritiker sehen darin eine Verwässerung der zuvor hohen Ambitionen. Gleichzeitig wurde die 2035-Spanne von 66,25 bis 72,5 Prozent beschlossen – ebenfalls ein Kompromiss, der weit hinter früheren Vorstellungen zurückbleibt.
Mehrere Regierungen, darunter Polen, Ungarn und Tschechien, hatten auf wirtschaftliche Ausnahmen gedrängt. Sie verweisen auf energieintensive Industrien, die unter zu hohen CO₂-Kosten leiden. In Brüssel wird zunehmend ankerkannt, dass der europäische Green Deal zu einer Frage des Überlebens industrieller Wettbewerbsfähigkeit geworden ist.
Ungarns Doppelrolle
Ungarns Klimabilanz zeigt zwei Gesichter. Zwischen 2005 und 2023 verzeichnete das Land laut dem European Parliamentary Research Service einen Rückgang der Netto-Treibhausgasemissionen um rund 32,5 Prozent, während die Emissionen pro Kopf um etwa 26 Prozent sanken. Auf dem Papier ein großer Fortschritt – doch Budapest präsentiert sich auf EU-Ebene als Bremser.
Ministerpräsident Viktor Orbán und Außenminister Péter Szijjártó argumentieren, der europäische Klimapfad überfordere ärmere Mitgliedsstaaten. Im März 2024 verweigerte Ungarn die Zustimmung zu einem zentralen EU-Naturschutzgesetz und verlangte Nachverhandlungen. Auch beim 2035- und 2040-Ziel drängte die Regierung auf wirtschaftliche Flexibilität. So steht Budapest exemplarisch für jenen Flügel der EU, der Klimaschutz in erster Linie als Kostenfaktor begreift und Brüsseler Initiativen traditionell mit politischem Misstrauen begegnet.
Diplomatische Konsequenzen – Glaubwürdigkeit auf dem Prüfstand
In Belém droht der EU, als moralisch motivierter, aber politisch geschwächter Akteur aufzutreten. China hatte im Herbst einen Emissionsrückgang von 7 bis 10 Prozent bis 2035 angekündigt – weit unter den Erwartungen Europas. Hoekstra nannte die chinesischen Pläne „clearly disappointing“, worauf Peking der EU „Doppelstandards“ und „mangelnden Respekt“ vorwarf.
Gleichzeitig steht der europäische Ansatz beim sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in der Kritik. Schwellenländer sehen in der CO₂-Grenzabgabe ein protektionistisches Instrument, das sie aus dem europäischen Markt drängen soll. Bislang war es oft die USA, die Brüssel bei solchen Streitfragen Rückendeckung gaben – diesmal steht die EU allein.
Die fehlende US-Präsenz und die Schwäche interner Geschlossenheit machen die Union angreifbar. Auf Themen wie Klimafinanzierung, Handel und Verantwortung für historische Emissionen könnte sie in Belém besonders unter Druck geraten.
Europas Prüfstein in Belém
Die EU will beim COP30 auftreten wie eine Führungsmacht – doch sie wirkt mit einer Hand gebunden. In Zeiten, da ein verlässlicher Partner fehlt, hätte sie Gelegenheit, ihre Ambition zu demonstrieren. Stattdessen liefert sie eine Kompromisslösung, die intern kaum geschlossen ist und extern als Schwäche wahrgenommen wird.
Ungarn fungiert dabei als Symbol: im Inland mit teils realen Fortschritten, in der Union als Wächter industrieller und nationaler Interessen. In Belém entscheidet sich, ob die EU ihre Doppelrolle zwischen moralischer Autorität und ökonomischer Vorsicht zu einer kohärenten Politik formen kann, oder ob sie zur Mahnerin ohne Macht wird.
Quellen: Politico EU, Euronews, Reuters, Sustainability Mag, European Parliamentary Research Service (EPRS), Guardian
Photo: Eröffnung des COP30, Ricardo Stuckert / PR