In Budapest klettern die Mietpreise um 18 Prozent. Trotz nominell wachsender Einkommen bleibt für viele Haushalte real immer weniger übrig. Die Inflation frisst den Lohnzuwachs auf, während der Wohnungsmarkt weiter unter Druck steht.
Budapest. Wer in der ungarischen Hauptstadt zur Miete wohnt, muss sich auf einen deutlich höheren Finanzaufwand einstellen: Die durchschnittliche Monatsmiete liegt laut aktuellen Zahlen von Duna House inzwischen bei 274.000 Forint: ein Anstieg von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders betroffen sind zentrale und grüne Stadtteile wie der II. Bezirk (485.000 Forint), der V. Bezirk (433.000) sowie der Burgbezirk (366.000). Am unteren Ende der Skala liegen der X. und XV. Bezirk, wo die Mieten mit rund 191.000 Forint noch verhältnismäßig niedrig ausfallen.
Im selben Zeitraum sind die Bruttolöhne in Ungarn um rund neun Prozent gestiegen. Das Zentralamt für Statistik (KSH) meldet für Juli ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 693.700 Forint, netto bleiben 479.500 Forint. Rechnet man die Inflationsrate von 4,3 Prozent ein, ergibt sich ein realer Lohnzuwachs von lediglich 4,9 Prozent – nicht einmal halb so viel wie der Mietpreisanstieg in der Hauptstadt.
Die Schere zwischen Einkommen und Wohnkosten öffnet sich damit weiter. Noch im Vorjahr betrug die Differenz zwischen den Mietpreisen in Budapest und anderen Universitätsstädten wie Debrecen oder Pécs etwa 50.000 Forint, mittlerweile sind es 82.000. Ein Zwei-Zimmer-Apartment in Debrecen kostet im Schnitt 269.000 Forint, also ähnlich dem Niveaus Budapests. In westungarischen Städten wie Győr oder Veszprém liegt der Durchschnitt noch niedriger, wenngleich auch im Steigen inbegriffen.
Der Preisanstieg am Mietmarkt ist kein isoliertes Phänomen. Er vollzieht sich parallel zu einer angespannten Situation auf dem Immobilienmarkt. Die Zahl der verfügbaren Mietwohnungen bleibt niedrig, während sich Nachfrage, insbesondere durch Studierende sowie zahlungskräftige Expats weiter verdichtet. Hinzu kommt, dass ein nicht unerheblicher Teil des Wohnraums der Kurzzeitvermietung über Plattformen wie Airbnb entzogen wird. Gesetzliche Einschränkungen für diesen Sektor sind zwar seit Jahren in der Diskussion, lassen aber auf sich warten.
Während die Regierung mit Steuererleichterungen für Familien und Kinder argumentiert, verfehlt sie bislang eine strukturelle Antwort auf die zunehmende Wohnkostenbelastung in urbanen Räumen.
Zwar profitierten vor allem kinderreiche Haushalte von den jüngsten Lohnentwicklungen, doch gerade für Alleinlebende oder junge Berufstätige, die über kein Wohneigentum verfügen, wird die Lage zunehmend prekär. Der Stadtregierung sind die Hände finanziell unter anderem aufgrund der sehr umstrittenen Solidaritätsabgabe an den Bund gebunden: es ist kaum möglich langfristige Investitionen wie öffentlichen Wohnbau in großem Maße zu tätigen.
Budapest bleibt wie anderen osteuropäischen Metropolen nicht verschont: ein rasant wachsender Immobilienmarkt, oft stagnierende reale Einkommen und eine Sozialpolitik, die mit Blick auf den Wohnsektor keine geschlossene Strategie erkennen lässt. Ein weltweiter neoliberaler Trend, der das soziale Gefüge der Stadt schleichend, aber nachhaltig verändert.
Quellen: MTI.hu
Titelbild: Wohnungen in Budapests 13. Bezirk, alexbarrow, Wikicommons
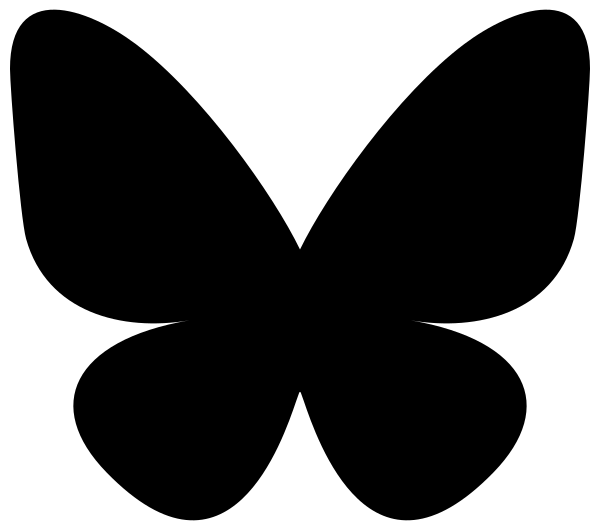




Gib den ersten Kommentar ab