Bukarest. Rumänien hat sein jahrzehntelanges Schweigen über den Porajmos, den Holocaust an der Roma-Minderheit, endlich gebrochen. Am 31. Juli 2025 nahm Präsident Nicușor Dan an einer Gedenkzeremonie für die im Holocaust ermordeten Roma teil. Bei einer offiziellen Zeremonie vor dem Holocaust-Denkmal in Bukarest wurde dem offiziellen Schweigen ein Ende gesetzt. Der Anfang eines umfassenderen gesellschaftspolitischen Lernprozesses.
Nur wenige Meter vom einstigen Sitz der Securitate entfernt steht das nationale Holocaust-Memorial für Rumäniens Opfer jüdischer sowie roma-sinti’scher Herkunft. Dieser Ort, eingeweiht 2009, erinnert in seiner Gestaltung an die Ermordung von 280.000 Jüdinnen und Juden sowie 25.000 Roma durch die rumänische Antonescu-Diktatur und deren Nazi-Verbündeten. Zentrale Elemente sind eine Eisen-Säule mit der Inschrift „Zachor“ (Erinnere), die Via Dolorosa als Symbol der Deportationszüge, einen Davidstern und ein Rad – Sinnbild der Roma‑Identität. Die dauerhafte Einbeziehung des Roma‑Rades war lange Zeit umstritten. Erst durch anhaltenden Druck der Zivilgesellschaft wurde es sichtbar in das Ensemble integriert. Ein Symbol für den Weg ohne Rückkehr: als Roma während des Zweiten Weltkriegs nach Transnistrien deportiert wurden.

Geschichte mit der Gegenwart verbinden
Die Teilnahme von Präsident Nicușor Dan an der Gedenkveranstaltung zwei Tage vor dem europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma (2. August, der Tag der Liquidierung des sogenannten „Zigeunerfamilienlagers“ in Auschwitz 1944) hat Symbolkraft.
Minister Petre Florin Manole – der erste Roma-Minister in der Geschichte Rumäniens – warnte eindringlich: Demokratische Defizite seien wesentlich gefährlicher als Budgetäre Mängel. Manole kritisierte die selektive Anwendung bestehender Antirassismus-Gesetze.
Mircea Dumitru, Vizepräsident der Rumänischen Akademie, betonte: Das langjährige Schweigen habe Roma-Opfer auch im Tod unsichtbar gemacht. Er erinnerte mit einem Zitat des Bürgerrechtlers Romani Rose: Porajmos sei keine historische Fußnote, sondern eine Warnung was geschehe, „wenn Hass Gesetz wird“.
Historisches Schuldeingeständnis
Offiziell wurde Rumäniens Beteiligung am Holocaust erst durch den Bericht der internationalen Wiesel-Kommission 2004 anerkannt. Bis dahin war der Porajmos im öffentlichen Diskurs quasi unsichtbar – er spielte keine Rolle in Lehrplänen oder politischen Debatten. Erst seit 2020 existiert mit dem 2. August in Rumänien ein gesetzlicher Gedenktag für den Roma-Holocaust.
Die Haltung von Präsident Dan drückt klar eine neue Priorität aus: „Es ist unsere Pflicht, die Geschichte zu kennen und anzuerkennen“. Rumänien neige dazu, seine Probleme nach außen zu verlagern, statt sie zu konfrontieren.
Bildung als Instrument gegen Verdrängung
Iulian Paraschiv, Staatssekretär und Leiter der Nationalen Agentur für Roma, betonte, die Roma seien „Teil der rumänischen Nation seit der Gründung des modernen Nationalstaats“. Vielfalt müsse als Ressource verstanden werden, nicht als Vorwand für Ausgrenzung.
Catalin Manea, Berater der Regierung und Vertreterin einer Roma-Partei, kündigte die Aufnahme des Themas Roma-Sklaverei und Deportation in die offiziellen Schulcurricula an sowie ein nationales Museum der Roma-Kultur.
Rumänien steht damit erstmals deutlich zu seiner düsteren Geschichte und beendet Jahrzehnte des Verdrängens.
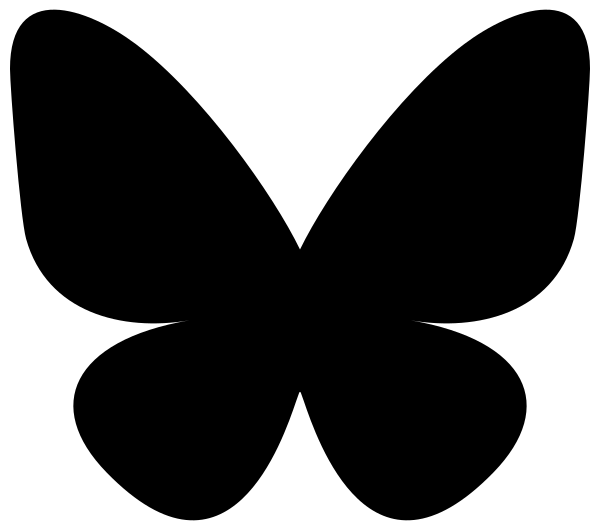




Gib den ersten Kommentar ab