Budapest/Mailand. Péter Szijjártó hat es wieder einmal geschafft, sich auf der internationalen Bühne als energiepolitischer Pragmatiker zu inszenieren: Zehn Jahre, zwei Milliarden Kubikmeter Gas – geliefert ab 2026 vom britisch-niederländischen Konzern Shell. Es ist der erste langfristige Gasliefervertrag Ungarns mit einem westlichen Anbieter. In Mailand, stilgerecht flankiert vom Shell-Vizepräsidenten für Europa und Afrika, Bob Kijkuit. Szijjártó sprach von einem „historischen Schritt“, einer „echten Diversifizierung“.
Große politische Geste bei kleinem Liefervolumen
Zunächst zur Größe: Zwei Milliarden Kubikmeter in zehn Jahren bedeuten jährlich etwa 200 Millionen, also rund drei bis vier Prozent des ungarischen Gesamtverbrauchs. Die restlichen 96 Prozent kommen weiterhin mehrheitlich (80%+) aus Russland, über Pipelines, deren vertragliche Grundlagen bis mindestens 2036 laufen. Auch künftig wird Gas aus Osten durch die Rohre strömen, mit oder ohne Shell.
Der neue Vertrag ersetzt also keine russischen Lieferungen, ergänzt lediglich. Noch ist unklar, über welchen Weg Shell das Gas überhaupt liefern will. Möglich ist Flüssiggas (LNG), etwa über Terminals in Kroatien, Italien oder den Niederlanden. Doch alle genannten Optionen stehen unter schwierigen Vorzeichen: ob die Kapazitäten dafür überhaupt existieren, ist unklar. Seit dem russischen Angriffskrieg haben nahezu alle Europäischen Staaten ihren Bedarf langfristig auf LNG umgestellt – dementsprechend ausgebucht sind die bestehenden Terminal-Kapazitäten. Ungarn ist schlichtweg sehr spät dran, seine Energieversorgung zu diversifizieren.

Unklare Herkunft und problematische Infrastruktur
Shell selbst äußerte sich bislang nicht zur Herkunft des Gases. Insider vermuten LNG aus Katar, den USA oder Nigeria. Damit hängt der Erfolg des Deals maßgeblich an den Hafenterminals, durch die das Gas in Europa anlandet und den Pipelines, die es von dort nach Ungarn bringen. Gerade auf dieser West-Ost-Achsen herrscht seit Kriegsbeginn ein Rückstau: Länder wie Polen, Tschechien oder die Slowakei haben ihre Infrastruktur bereits auf „russlandfrei“ umgestellt und beanspruchen bestehende Kapazitäten. Ungarn hingegen hinkt dieser Entwicklung sichtbar hinterher: wohlbekannt nicht aus technischem Unvermögen, sondern politischer Absicht.
Zwar mahnt Brüssel zur Eile, bislang hielt Budapest jedoch demonstrativ an seinen langfristigen Verträgen mit Gazprom fest. Für Viktor Orbáns Regierung bleibt Russland der Hauptlieferant: ideologiefrei, wie es heißt. Dass nun ein westliches Unternehmen wie Shell dazukommt, wird zwar als Fortschritt verkauft, doch an den strategischen Prioritäten ändert sich wenig.
Der energiepolitischer Eiertanz
Die EU will mittelfristig sämtliche Mitgliedsstaaten von russischem Gas unabhängig machen. Ungarn hingegen nutzt jeden Spielraum, um seine energiepolitische Eigenständigkeit zu betonen. Der Shell-Vertrag ist da willkommene PR: gegenüber der EU genauso wie mutmaßlich gegenüber Moskau, wo dringend nötige Verhandlungsmacht aufgebaut werden soll.
Die Regierung kann Brüssel demonstrieren, dass sie nicht ausschließlich auf Russland setzt, aber verbrämen will man Putin wohl auchnicht: Szijjártó betonte ausdrücklich, dass der neue Vertrag „nichts ersetzt“, sondern lediglich ergänzt.
Shells Jubiläum
Für Shell kommt das Abkommen zur rechten Zeit: Das Unternehmen feiert sein 100-jähriges Bestehen in Ungarn, ist vor allem im Tankstellengeschäft präsent. Mit rund 200 Standorte im Land und 100 Elektroladestationen. Mit dem neuen Vertrag steigt Shell in eine neue Rolle: als strategischer Partner der ungarischen Gasversorgung.
Um ein „Flaggschiffprojekt“, wie Szijjártó es formulierte, handelt es sich kaum. Für die Energiesicherheit Ungarns ändert sich damit nur wenig.
Quellen: MTI, Wikinews
Titelbild: Shell Tanklaster, Alf van Beem, Wikicommons
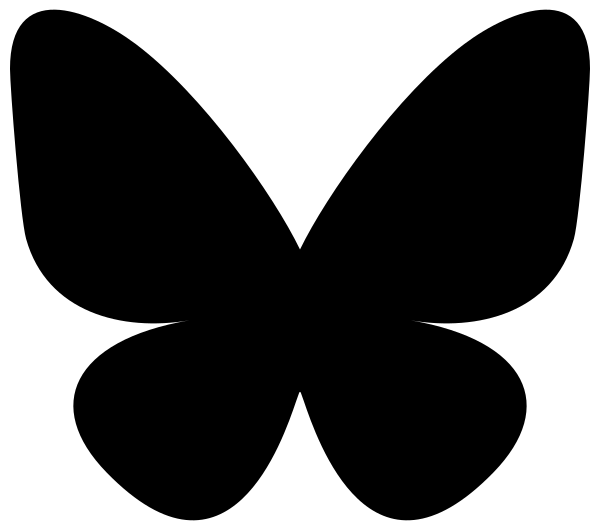




Gib den ersten Kommentar ab