Ungarns Reaktoausbau Paks II gerät durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs erneut in den Fokus
Budapest/Bruxelles/Berlin/Beijing. Das umstrittene Kernkraftwerk Paks II ist erneut in den Fokus von Recht, Politik und Geopolitik gerückt. Ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs erklärt die staatliche Förderung des Projekts für nicht ausreichend im Einklang mit EU-Vergaberecht und fordert eine Neuevaluierung nach dem ursprünglichen Urteil von 2017. Gleichzeitig signalisiert Ungarn stärkere Kooperation mit China und beschwört so erneut Fragen nach Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und strategischer Unabhängigkeit herauf. Anstelle europäischer Partner setzt Ungarn notorisch auf Ost und Fern-Ost, trotz geopolitischer Widersprüche.
Hintergrund
Der EuGH hat am 11. September 2025 die Entscheidung der Europäischen Kommission von 2017 aufgehoben, die Ungarns staatliche Beihilfen für Paks II genehmigte. Grund: Die Kommission hatte versäumt nachzuweisen, dass die direkte Auftragsvergabe an Rosatom ohne Ausschreibung mit EU‑Vergaberegeln vereinbar sei. Die erneute Prüfung geht auf einen Einspruchs Österreichs zurück, dass traditionell als Atomenergiefreie Nation Staatliche Förderungen und EU-Förderungen für Nuklearenergie ablehnt.
Ungarn reagiert gelassen, sprach gar von einem rechtlichen Sieg. Außenminister Péter Szijjártó betonte, das Urteil richte sich gegen die Kommission, nicht gegen den Ausbau. Die Fertigstellung der zwei neuen Reaktorblöcke samt Netzanschluss sei weiterhin für die frühen 2030er geplant.
Der politische Kontext: Ungarns Strategie im juristischen Geplänkel
Ungarn setzt auf eine mehrgleisige nukleare und geopolitische Strategie:
- Es unterzeichnete jüngst ein Abkommen mit der chinesischen Atomenergiebehörde, mit dem Ziel, Kooperationen in Kernenergie, Sicherheit und Innovation auszubauen.
- Szijjártó erklärte bei einer Konferenz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien, dass trotz „Angriffen“ und „Behinderung“ der Ausbau von Paks II beschleunigt werde. Die Kapazität von 2.400 MW durch die neuen Blöcke solle Ungarns Atomstromanteil auf rund 70 % steigern. Gleichzeitig betonte er, dass der nationale Energiemix prinzipiell souveräne Entscheidungen seien.
Diese Politik passt zu Ungarns Kurs der „Östlichen Öffnung“ (Keleti nyitás): wirtschaftliche Verflechtung mit Russland und China, gepaart mit strategischer Autonomie gegenüber Brüssel und Washington.
Brüssels Kontroll‑mechanismen unter Druck
Das Paks‑II-Verfahren wirft Fragen auf, wie wirksam und durchsetzbar EU‑Regeln sind:
- Das EuGH‑Urteil zeigt, dass die Kommission nicht hinreichend geprüft oder dokumentiert hat, wie und warum Ausnahmen vom Vergaberecht gerechtfertigt werden können.
- Dennoch betont Ungarn, dass Projekt und Zeitplan nicht infrage stünden. Die Regierung sieht sich nicht rechtlich gehindert, fortzufahren.
- Brüssel steht vor einem Dilemma: Entweder es zwingt Schritte wie Rückforderungen von Geldern oder Einhaltung zusätzlicher Kontrollen durch, oder es signalisiert, dass Verletzungen von Vergaberecht toleriert werden – mit möglichen fatalen Präzedenzwirkungen für andere Mitgliedstaaten.
Implikationen
Die aktuelle Entwicklung bedeutet für Ungarn mehrere Herausforderungen:
- Rechtliche Unsicherheit: Sollte Brüssel weitere Verfahren einleiten, etwa Rückzahlungen verlangen, könnten Kosten und zeitliche Verzögerungen steigen.
- Image und Außenpolitik: Ungarn ist starker Kritik ausgesetzt: nicht allein wegen Rechtsfragen, sondern auch wegen seiner Nähe zu China und Russland in sicherheits‑ und energiepolitisch sensiblen Bereichen. Angesichts des Ukraine-Krieg und der stärkeren wirtschaftlich-militärischen Unterstützung Chinas für Russland ein delikates geopolitisches Thema.
- Öffentliche und EU‑politische Legitimität: Transparenz und Rechenschaftspflicht sind zentrale Elemente der Rechtsstaatlichkeit. Das EuGH‑Urteil stärkt Oppositionsparteien und zivilgesellschaftliche Kräfte innerhalb Ungarns, die auf EU‑Rechtsnormen bestehen.
Paks II steht nach wie vor für die Spannungen zwischen nationaler Energiepolitik, internationaler Sicherheit und europäischer Rechtsordnung. Ungarns Führung hält am Ausbau fest: auf Basis, wie sie betont, souveräner Entscheidungen und diverser Partner – Szijjarto betonte dass nicht alleine das russiche ROSATOM Vertrabspartner sei, sondern mehrere Europäische Subunternehmer im Auftrag von ROSATOM an Paks II beteiligt sind. Brüssels Macht hingegen wird daran gemessen: Wie entschieden lassen sich Vergaberegeln durchsetzen, wenn Mitgliedstaaten sie zur Seite schieben? Der Ausgang wird über Strom und Reaktoren entscheiden und über die Glaubwürdigkeit der EU als Rechts‑ und Wertegemeinschaft.
Quellen: Pester Lloyd, vienna.at, Greenpeace, energiaklub.hu, World Nuclear News, Telex, MTI.hu
Titelbild: Kernkraftwerk Paks, Ungarn. Foto über Wikipedia.
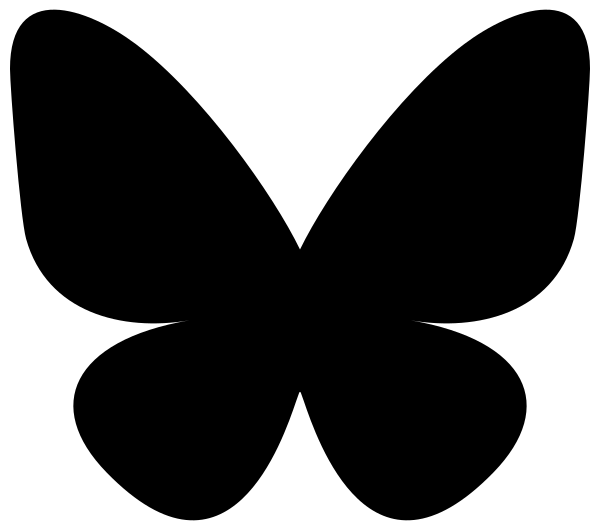




Gib den ersten Kommentar ab